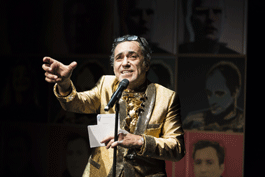Marstall Der Schweinestall von Pier Paolo Pasolini
„Schweinisches“ Theater
Julian Klotz ist Sohn des Industriellen Klotz, im „Dritten Reich“ ein großer Waffenschmied, gleich nach Krupp. Vater Klotz hat den nahtlosen Übergang in die bundesdeutsche Demokratie geschafft und gehört längst wieder zu den Eliten, zu denen, die im Land das Sagen haben. Im Jahr 1967 bekommt er Besuch von einem alten Kameraden: August Hirt. Bei Hirt handelte es sich um eine authentische Figur, einem Arzt, der ab dem 1. Oktober 1941 der Direktor des Anatomischen Instituts der neugegründeten Reichsuniversität Straßburg und nachweislich für den Tod von 86 Menschen verantwortlich war. Der Mann hatte sich am 2. Juni 1945 das Leben genommen, um sich der Gerichtsbarkeit der Siegermächte zu entziehen. Pasolini lässt die Figur nach einer Gesichtsoperation und einem Namenswechsel, jetzt Herdhitze, weiterleben.
Herdhitze ist in der Wirtschaft ebenfalls erfolgreich. Beide Magnaten begreifen sich sofort als Konkurrenten und arbeiten jeweils an der feindlichen Übernahme des anderen. Klotzs Druckmittel auf Herdhitze ist seine Kenntnis von dessen Identität. Herdhitze erpresst Klotz mit seinem Wissen um das Treiben des Juniors Klotz. Der treibt es nämlich mit Schweinen. Allerdings handelt es sich hier nicht um eine perverse Neigung, sondern es ist das Ergebnis aus Julians Unverträglichkeit der bundesdeutschen Realität. Gegenpol zur Altnazigesellschaft ist die junge Studentin Ida, die im Studienort Berlin in der studentischen Protestbewegung aufgeht und die versucht, Julian einen Ausweg aus dem noch immer faschistischen Elternhaus zu bieten.
Julian ist ein sensibler junger Mann, der sich von jeder Ideologie abgestoßen fühlt. Wahrhaftig erscheint ihm nur die Natur, die Vögel, mit denen er sich zwitschernd unterhält, vor allem aber die Schweine. Ihnen ist er in grenzenloser Liebe verbunden und wann immer sich die Gelegenheit bietet, schleicht er zu den Ställen. Ida, die erkennen muss, dass sie nie einen Zugang zu Julian finden wird, wendet sich von ihm ab und heiratet. Am Ende wird Julian, der angewidert vor den inzwischen freundschaftlichen Fusionsfeierlichkeiten der Unternehmen Klotz und Herdhitze zu den Schweinen flieht, von denen gefressen. Pasolinis Resümee über seinen Film „Porcile“ (1969), der übrigens nie in den deutschen Verleih gelangte: „Die vereinfachte Botschaft des Film ist folgende: die Gesellschaft, jede Gesellschaft, frisst ihre ungehorsamen Kinder.“
Regisseur Ivica Buljan inszenierte mit „Der Schweinestall“ (1966 geschrieben) erstmalig in Deutschland. Seine Bühnenästhetik erklärte er in einem Interview mit Thorben Meißner im Programmheft: „Ich versuche Theater zu machen, das performative Elemente in Formen des klassischen Sprechtheaters integriert. Theater besteht für mich in der Reproduktion eines Textes, während Darstellung im Moment stattfindet, sie ist die Kunst des Moments mit all seinen Gefahren und Chancen.“ Übersetzt auf seine „Schweinestall“-Inszenierung im Marstall bedeutete das, dass eine Vielzahl von Liedern eingefügt wurden, dass er im Augenblick des inszenatorischen Vorgangs ‚performative Elemente“ erfindet. Das erinnert an Frank Castorf und so verwunderte es auch nicht, dass der Bühnenbildner für die Marstall-Inszenierung Aleksandar Denić war, der auch sämtliche Bühnenbilder für Castorf am Residenztheater entwarf. Und tatsächlich, Ähnlichkeiten waren nicht zu übersehen. Denićs Bühnenbild teilte sich in drei Teile, links ein Schweinkoben mit Stall und Flechtzaun und im zweiten Teil drei echten Schweinen, im Mittelteil sehr elegant eine rote Hochglanz-Fassade mit mondgroßem, kreisrunden Ausschnitt und gleichfarbigem Boden, und rechts eine Remise mit Gerümpel und Vergangenem. Über der Remise ein Balkon, auf dem die Band Platz nahm, erreichbar über eine Trittleiter.
 |
||
|
Nora Buzalka, Philip Dechamps © Matthias Horn |
Nora Buzalka eröffnete das Spiel mit einem Text, den sie, so Ivica Buljan, selbst entwickelt hatte. Ihre Rolle dabei war Zaúm, eine Figur, die Pasolini zwar angedacht und geschrieben, jedoch im Film nicht verwendet hat. Zaúm ist ein Double Julians, oder besser, der freiere, in der Gesellschaft nicht gebunden oder bevormundete Gegenentwurf. Philip Dechamps Julian war überaus zerbrechlich und sensibel, so sensibel, dass er angesichts der unerträglichen Zustände im Elternhaus in eine dreimonatige Katalepsie fiel. Am Ende, bevor er sich den Schweinen auslieferte, hielt er einen großen Schmerzensmonolog. Dabei kam wieder das „Prinzip Castorf“ zur Anwendung. Dechamp stemmte während des gesamten Monologs einen Baumstamm über den Kopf. Der sichtbare Schmerz, den dieser Kraftakt erzeugte, verschmolz mit dem Text und hinter dem Darsteller Philip Dechamps wurde der Mensch Philip Dechamps sichtbar. Genija Rykovas Ida war die einzige Hoffnungsträgerin in dem ganzen dekadenten Panoptikum. Ihre Reinheit konnte auch Regisseur Ivica Buljan im Sinne Pasolinis bewahren, der sich selbst vorwarf, seine weiblichen Figuren „zu raphaelisieren, ihre engelhafte Seite“ zu betonen. (Programmheft). Diesen Vorwurf konnte man Regisseur Buljan nicht machen, denn Juliane Köhlers Mutter Klotz gerierte sich jenseits aller Wohlanständigkeit und bürgerlicher Artigkeit. Ihre sadistischen Neigungen bekam auch Eheman Klotz zu spüren, Götz Schulte gab ein tumb wirkendes, doch nicht dumm seiendes Großmaul, der aussprach, was peinlich war und auch die Etikette, so es eine gab, verletzte. Schulte kam daher wie ein texanischer Ölmilliardär. In Pasolinis Film saß Klotz sen. im Rollstuhl, geschmückt von einem Hitler-Bärtchen. Bijan Zamani spielte einen mafiösen, gleichsam mit allen schmutzigen Wassern gewaschenen Herdhitze.
Gegen Ende des Stücks, Julian verbrüderte sich nackt mit den Schweinen, erschien der Geist des niederländischen Philosophen Baruch Spinoza, um Julian philosophische Ratschläge zu geben, wie er mittels der Vernunft in der Gesellschaft als souveränes Individuum bestehen könnte. Diese Rolle fiel Sibylle Canonica zu, die in der Premierenvorstellung mit ihrem Part, die spinozistische Ethik und die „Lehre von Affekten und Leidenschaften“ zu erklären, kläglich scheiterte. Dabei wurde die vielleicht bemerkenswerteste Schwäche der Inszenierung deutlich, die zwischen musikalischer und spielerischer Ekstase und poetischer Deklamation hin und her wechselte, ohne dass die Handlung wirklich amalgamierte. Die „performativen Elemente“ ließen eine einheitliche, in sich geschlossene Geschichte nicht wirklich zu. Tiere auf die Bühne zu bringen, ist und war schon immer ein gewaltiges Risiko, das zumindest Sibylle Canonica teuer bezahlte. Da half ihr auch der Notruf „Ich werde noch wahnsinnig in diesem Schweinestall!“ nicht weiter.
Die Vielfalt der beeindruckenden Kostüme, insbesondere die der Frauen (Ana Savić Gecan) war durchaus eine Augenweide, doch auch sie unterstrich nur die Brüchigkeit und Sprunghaftigkeit des Konzeptes, das mehr auf Effekt setzte als auf gediegene Eindringlichkeit. Sämtlichen Darstellern konnte gutes bis sehr gutes Schauspiel bescheinigt werden, allein, es fügte sich nicht zu einem ästhetisch homogenen, verständlichen Ganzen. Vermutlich lag das auch gar nicht in der Intention des Regisseurs, dessen kluge und schlüssige Ausführungen im Programmheft durchaus überzeugten.
Vielleicht wäre es besser gewesen, den Zuschauern die Schweine zu ersparen. Das hat schon in Johan Simons „König Lear“-Inszenierung 2013 an den Kammerspielen nicht funktioniert. Für Tiere gibt es Hellabrunn. Eine dramaturgische Notwendigkeit und ein ästhetischer Gewinn waren jedenfalls nicht erkennbar. Auch der Geruch hat nichts ausgelöst, was der Geschichte dienlich gewesen wäre. Für „schweinisches“ Theater braucht es keine Schweine.
Wolf Banitzki
Der Schweinestall
von Pier Paolo Pasolini
Mit: Philip Dechamps, Genija Rykova, Götz Schulte, Juliane Köhler, Bijan Zamani, Götz Argus, Sibylle Canonica, Jürgen Stössinger, Nora Buzalka
Regie: Ivica Buljan