Kammerspiele Dionysos Stadt von Antikenprojekt von Christopher Rüping
Grandios … an die Wand gefahren
Seit langem angekündigt und mit Spannung und auch Unbehagen erwartet: „Dionysos Stadt“, das Antikenprojekt von Christopher Rüping. Nun war es endlich soweit und ein ungeduldiges Publikum hatte sich in den Kammerspielen, deren Plätze nicht alle besetzt waren, eingefunden. Sehr schnell wurde deutlich, dass sich viele Kollegen, vor allem aber Schauspielstudenten eingefunden hatten. Das Unbehagen wuchs. Und dann ging es auch irgendwie los. Nils Kahnwald plauderte sich in den Prolog hinein, erklärte die Abläufe des Abends, und natürlich verzichtete er nicht auf die von allen scheinbar erwarteten Witzeleien. Es fanden auch die üblichen Mätzchen statt. Stichwort “Szenisches Rauchen“. Auf der Bühne war eine Raucherecke eingerichtet worden, eine Bank aus dem Garten der Kammerspiele, auch für das Publikum. Deren Bedürfnisse wurden allerdings durch eine Raucherampel (Rot und Grün) reguliert. Toll, man fühlte sich ganz wie Zuhause. Einem Zuschauer wurden 50 Euro versprochen, wenn er bis zum Schluss durchhält. Noch ein paar Anmerkungen zu kommenden gruppendynamischen Einlagen, wie gemeinsames Swingen, Klatschen und Bodysurfing, und los ging’s.
Erster Teil: Prometheus. Dem Gott war es zur Aufgabe gemacht, den Menschen zu erfinden. Er, gespielt von Benjamin Radjaipour, tat es und er gab, eine Sünde, für die er schwer büßen musste, den Menschen das Feuer und damit den freien Willen, sich zu entwickeln. Zeus zürnte ihm nicht nur, sondern ließ ihn an den Felsen des Kaukasus schmieden, wo er sich 3000 Jahre lang von einem Adler tagtäglich die Leber aus dem Leib hacken lassen und sich vom Kot des Adlers, der sich über ihn entleerte, ernähren musste. Bald war Benjamin Radjaipour, in einem Käfig hoch im Bühnenhimmel hängend mit weißem „Kot“ bedeckt. Textgrundlage war „Prometheus gefesselt“ nach der Übersetzung von Heiner Müller und John von Düffel, aber auch Texte von Platon, Goethe und Heiner Müller fanden Eingang. Besonders die Müllertexte entfalteten eine archaische Wucht und eine grandiose Bilderwelt im Auge des Betrachters. Die Bühne von Jonathan Mertz war weitestgehend leer und es bedurfte auch weiter nichts, denn die Sprachkulissen sogen den Zuschauer in eine gigantische archaische Bilderwelt. Mittendrin, Prometheus war ja für Äonen mit seinem Leid beschäftigt, wurde die Geschichte der Io erzählt, die Mutter aller Griechen und vor allem eines besonderen, Herakles, der Prometheus vom Felsen erlösen sollte. Die quirlige Maja Beckmann, gehörnt und von einer lästigen Bremse geplagt, erfuhr ihr Schicksal aus dem Munde Prometheus’ und schickte sich drein, denn in jedem Aufbruch liegt ja der Beginn eines Unterganges. Hier sollte es der von Zeus sein.
Der, arabisch und englisch sprechend, göttlich-propper von Majd Feddah gespielt, brachte das Grundproblem auf’s Tapet. Prometheus hatte dem Menschen die Freiheit und damit die Wissenschaft und die Technologien gegeben, und Zeus wäre nicht Zeus, wenn er nicht im Voraus sehen könnte, was der Mensch damit machen würde. Der Mensch würde „Bomben“ bauen und sich gegenseitig vernichten! Und, nachdem Herakles Prometheus in einer dreitausend Jahre währenden Rettungsaktion endlich vom Felsen gepickt und triumphal nach Hause gebracht hatte, sollte der zweite Teil des Abends den Beweis für die These von Zeus erbringen. Doch zuvor kam es zu einer Deklamation von Goethes Ballade „Prometheus“. Das war ein Moment mit Gänsehauteffekt. Zuletzt betrat ein Mann die Szene, der den zweiten Teil ästhetisch sehr stark dominieren sollte, der Drummer Matze Pröllochs. Er brachte dezent, aber bestimmt trommelnd den Menschen auf seinen Weg, auf dem der militärische Gleichschritt bald der Rhythmus werden sollte. Die zwei Stunden vergingen wie im Flug und die darstellerische Leistung euphorisierte, oder um es mit Goethe zu sagen: „Im Tale grünet Hoffnungsglück.“ Es war fesselndes Theater mit einer Fragestellung, die brennend aktuell ist.
Für den zweiten Teil mit dem Titel: „Troja. Der erste Krieg", hatte Bühnenbildner Jonathan Mertz ein mehrstöckiges Gerüst, versetzt mit weißen Wandplatten errichtet, in dessen Erdgeschoss das Schlagzeug von Matze Pröllochs integriert war. Das Gebäude war die Stadt Troja, auf deren Wänden bald der Widerschein eines entfesselten Krieges flackern sollte, und die zuletzt in Scherben ging. Peter Brombacher erschien als Moira, das Schicksal, und erklärte den Aufmarsch und die Stärke des von den griechischen Helden angeführten Heeres. Dass er sich dabei eines Telepromters bedienen musste, war absolut nicht anstößig. Für diesen Text hätte er vermutlich den ganzen „Lear“ lernen können und es wäre vermutlich leichter gefallen. Der Krieg begann zu toben, kommentiert von Brombachers Moira und Gro Swantje Kohlhofs Nyx, Göttin der Nacht. Über den satten und tragenden Elektroniksound von Jonas Holle trommelte Matze Pröllochs ekstatisch die Geräusche des Krieges. Laut war es, aber mitreißend, und ein Regen faszinierender Videobilder floss an den Mauern Trojas hinab. Die wichtigste Handlung: Die Helden schlachteten das gemeine Fußvolk, aber auch einander ab.
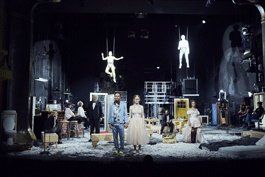 |
||
|
Ensemble © Julian Baumann |
Der drei Stunden währende Part, er hatte beinahe etwas von einem Rammsteinkonzert, war ein Rausch von artifiziellen Bildern, jeglicher Realismus blieb dabei außen vor, die das Blut in den Adern gefrieren ließ. Dieser Krieg, von Homer als Kunstwerk erschaffen, war ein Overkill, der, wenn der trojanische Krieg tatsächlich stattgefunden hätte, unbedingt eine Massenvernichtung gewesen wäre. Diesem Theorem von Zeus, formuliert in seiner Anklage gegen Prometheus, konnte an diesem Punkt nicht mehr widersprochen werden. Ein echter Höhepunkt dieses Teils war die Verteilung der Trojanischen Frauen an die griechischen Könige. Gro Swantje Kohlhof, Wiebke Mollenhauer und Maja Beckmann spielten die Hekabe, die Andromache, die Helena und die Kassandra und offenbarten dabei ein darstellerisches Vermögen, wie man es in den Kammerspielen seit langem nicht mehr gesehen hatte. Chapeau! Auch diese drei Stunden waren ausgesprochen kurzweilig.
Die Lautstärke hatte zudem die permanenten Begeisterungslacher aus den hinteren Reihen vergessen gemacht, die im ersten Teil auf sehr ablenkende Weise immer wieder die Frage aufgeworfen hatte, was ist hier komisch? Es liegt der Schluss nahe, dass hier nicht über witzige Inhalte gekichert wurde, denn es geschah zumeist bei martialischen Vorgängen, es war vielmehr ein anbiedernder Zuspruch an die gestandenen Kollegen, denen man lästig lautstark bedeuten wollte, wie unglaublich toll sie das doch machten. Sensibel ist jedenfalls anders. Im zweiten Teil hatten die Zeitgenossen, wie bereits angemerkt, allein schon wegen der Lautstärke kaum eine Chance.
Einen letzten Höhepunkt erlebte der Zuschauer, als Kassandra kurz vor ihrem Tod von einem Traum berichtete, in dem alles rückwärts ablief, bis zu dem Punkt der Unschuld. Die Bilder waren zum Teil überwältigend, beispielsweise, wenn Waffen Wunden auf wunderbare Weise wieder verschlossen. Oder der Sohn Hektors, den die Griechen von den Zinnen der Burg hinab geschleudert hatten, um ihn zu töten, wieder hinaufsprang, um in die Arme der Mutter gelegt zu werden. Und da waren sie wieder, die Lacher, die diese Bilder als komisch empfanden und wieder stellte sich die Frage, was geht in ihnen vor. Doch die Frage stellte sich nicht lange, denn was folgte, war offensichtlich ihr Element.
Vorerst ging man als Zuschauer von Begeisterung getragen in die einstündige Pause, hielt freudig erregt seine Brotzeit und war sich sicher, dass auch die verbleibenden drei Stunden Spielzeit keine Qual werden würden. Doch, das Schicksal ist bisweilen unbarmherzig. Der dritte Teil beinhaltete die „Orestie“ von Aischylos. Eingang fanden aber auch Passagen aus „Elektra“ von Sophokles und aus Stücken von Euripides zum Thema. Als die Anzeigetafel für die Surtitles daran erinnerte, dass im dritten Teil die Texte weitestgehend improvisiert werden und eine Übersetzung ins Englische daher nicht möglich sei, war das Unbehagen wieder da. Fortan blödelte man sich durch die Geschichte, in der gemordet wird und in der eine ganze Familie an einem Fluch zerbricht, der göttlich genannt wurde. Zwei junge Männer machten gänzlich unerwartet von dem im Prolog offerierten Angebot Gebrauch und stiegen während einer Bettszene von Klytaimnestra und Aigisthos auf die Bühne, setzten sich direkt neben dem Bett in die Raucherecke und stillten ihren Nicotinhunger. Das Königspaar reagiert indigniert, wie auch nicht, versuchten sie doch gerade einen künstlerischen Vorgang zu realisieren. Die Ampel stand auf Grün, also warum nicht Rauchen, wenn man nichts Besseres vor hat?
Zur Hochzeit von Elektra und Pylades bat man Teile des Publikums auf die Bühne. Es wurde ausgeschenkt und vorgeblich gefeiert. Nils Kahnwald verlor als Orest zunehmend den Verstand und demonstrierte dies, indem er die Hosen herunterließ, sich am Ende gänzlich entkleidete und zwischen dem auf der Bühne sitzendem Publikum herumgeisterte. Am schmerzlichsten allerdings war der Verlust der Sprache, die zuvor fünf Stunden lang Magie entfaltet hatte. Doch dem Publikum schien es zu gefallen und die Lacher liefen zu ganz großer Form auf. Umso verwunderlicher war die unfassbare Stille am Ende dieses Teils, als Matze Pröllochs als Apollon im silbernen Anzug wie Major Tom in den Bühnenhimmel gezogen wurde, von wo aus er verkündete, dass das Zeitalter der Rache von nun an beendet sei und das Zeitalter des Rechts beginnen würde. Nebenbei wurde auch Helena noch in den Himmel gezerrt, sie in Gold, denn der Ort war ihr zukünftiger Wohnsitz. Das Bild war von verstörender Kitschigkeit, die Lacher indes brachte es zum seligen Verstummen. Die Formlosigkeit, die das Ganze annahm, scheint eindeutig kein Sakrileg zu sein.
Betrachtet man noch einmal die Dramaturgie des Abends, so verblüffte sie mit der durchaus gerechtfertigten Anklage von Zeus, man hätte dem Menschen nicht die Freiheit der Entscheidung und Entwicklung geben dürfen. Tatsächlich können wir uns der Einsicht nicht verschließen, dass der Mensch in seiner ethisch-moralischen und weltanschaulichen Entwicklung mit der technologischen nicht schritthalten konnte und er in seinen negativen Charaktereigenschaften zum Spielball der realisierten Technologien geworden ist. Gegen die heutigen Kriege und Konflikte wirkt der trojanische Krieg wie ein dörflicher Konflikt, denn zu Zeiten des angenommenen Krieges im 12. Jahrhundert v.Ch. waren die Einwohnerzahlen von blühenden Metropolen vier- höchstens fünfstellig. Homer hat daraus einen Blockbuster gemacht. Allem Pessimismus zum Trotz hat Aischylos den Menschen bis an die Schwelle gebracht, die das menschliche Recht und die eigentliche humanistische Ordnung ermöglichte. Damit war Zeus allerdings nicht widersprochen, denn die menschliche Entwicklung steht heute am Scheideweg. Die derzeitigen Technologien sind für einen kollektiven Suizid und zwar der gesamten Menschheit, ausreichend. Nein, die Wirkung, die in den ersten zwei Teilen des Abends aufgebaut worden war, erfuhr einen peinlichen Abbruch und landete in der Banalität. Wie ein bockiges Kind war Christopher Rüping in seinen wohlgerichteten Sandkasten gesprungen und hatte die unfertige Kathedrale zertreten, geradezu als fürchtete er sich vor einem verbindlichen Ergebnis. Der Tespiskarren war grandios an die Wand gefahren.
Der Theatertag und das Projekt sollte die ruhmreichen Zeiten der antiken Dionysien beschwören, in denen das Volk der (freien) Griechen, von Athen subventioniert, zu einer großen Bildungsschau geladen wurden, um sich staatsbürgerkundlich weiter zu bilden. Verbunden war diese Veranstaltung mit dem religiösen Dionysoskult, was bedeutete, dass es sich dabei stets um höhere Bewusstseinsebenen handelte. Es ging um „vernünftige Ordnungen“, nach denen man suchte und dank Aischylos auch fand. Die „Orestie“ war ein Quantensprung in der menschlichen Entwicklung, vermutlich der wichtigste. Davon war in den Kammerspielen leider nichts zu spüren.
Die anstrengenden Tage der Dionysien endeten immer in Satyrspielen oder Komödien, in denen man es richtig krachen ließ. Immerhin, man saß täglich viele Stunden im Dionysos-Theater unterhalb der Akropolis und konsumierte Stücke, an denen mancher Zeitgenosse heute noch scheitert und sich in Ermangelung tieferer Einsichten durch die Veranstaltung kichert. Auch das Programm des Abends „Dionysos Stadt“ sah ein solchen Satyrspiel vor und es fand auch statt, allerdings stiftete es mehr Verwirrung als dass es Party war. Sämtliche Darsteller des Abends spielten als Satyrn verkleidet Fußball. Fünfundzwanzig Minuten schaute man erwartungsvoll zu, denn immer wieder hielt einer der Satyrn inne und starrte in den Himmel, wo zwei Screens einen solchen zeigten. Dann trat Nils Kahnwald ans Mikrofon und berichtete von der Melancholie des Fußballers Zidan. Ein paar poetische Zeilen, und es wurde weiter gekickt… Titel: Was hat das mit Dionysos zu tun? Das mögen zukünftige Besucher herausfinden.
Ein unbotmäßiger Gedanke zuletzt: Wäre zwischen 18.15 und 19.15 Uhr im Theater ein Feuer ausgebrochen, es wäre ein grandioser Abend geworden.
Wolf Banitzki
Dionysos Stadt
Antikenprojekt von Christopher Rüping
| Maja Beckmann, Peter Brombacher, Majd Feddah, Nils Kahnwald, Gro Swantje Kohlhof, Wiebke Mollenhauer, Benjamin Radjaipour, Live-Musik Matze Pröllochs Inszenierung: Christopher Rüping |