Cuvilliestheater Die Möwe von Anton Tschechow
Prädikat „Wertvoll“
Im Stück „Die Möwe“ gibt es „viele Gespräche über Literatur, wenig Handlung, ordentlich Liebe“, schrieb Tschechow über sein Werk. Zu meinen, es hätte darum keinen starken Plot, wäre unangemessen. Den erzählt zuerst der Schriftsteller Trigorin und später die junge Nina retrospektiv, deren eigene Geschichte in dem einen Satz zusammengefasst ist: „Der Zufall führt einen Mann an einen See, er sieht die Möwe, und in einer müßigen Laune stürzt er sie ins Verderben…“ Eine Möwe und ein Mensch kommen im Stück zu Tode und doch ist es kein normaler Plot, resultierend aus einem dramatischen Konflikt, dessen Lösung diese Opfer einfordert. Vielmehr ist es das ganz normale Leben, ein handlungsarmes, verzweifeltes, sehnsuchtsvolles, verworrenes und fehlgeleitetes. Zumindest trifft das auf eine Vielzahl der Charaktere zu. Konstantin Gawrilowitsch Trepljow, genannt Kostja, lebt in der Provinz auf dem Gut seines Onkels, des pensionierten Beamten Pjotr Nikolajewitsch Sorin, einem warmherzigen Mann, der sich selbst mit den Worten charakterisierte: Ich war der Mann, der wollte, jedoch nichts von alledem erreichte.
Kostja ist verliebt in Nina, Nina Michailowna Saretschnaja, die enterbte Tochter des Besitzers des Nachbargutes. Kostja hat ein Stück für sie geschrieben, das am Abend der Ankunft vor seiner Mutter, der berühmten Schauspielerin Irina Nikolajewna Arkadina, und ihrem Lebensgefährten Boris Alexejewitsch Trigorin, ein ebenso berühmter Schriftsteller, durch Nina als Darstellerin zur Aufführung gebracht werden soll. Die Aufführung scheitert am mangelnden Respekt der Arkadina ihrem Sohn und seinem Werk gegenüber. Nina, die schon vor der Ankunft Trigorins auf dem Gut für denselben schwärmte, offenbart sich ihm. Trigorin überredet Nina, ihm nach Moskau zu folgen, wo er eine kurze Affäre mit ihr unterhält, sie schwängert und verlässt. Im letzten Akt, nach dem vorigen sind zwei Jahre ins Land gegangen, hat sich der Status Quo für die Mehrzahl der Personen kaum verändert. Kostjas Arbeiten werden zwar gedruckt, finden aber kaum Resonanz, und er zweifelt längst an seinem Vorhaben, „neue Formen“ in der Kunst zu entwickeln.
Sein Onkel Sorin ist noch kränker und hinfälliger geworden und Wohlstand stellt sich auf dem Gut nach wie vor nicht ein. Mascha, die Tochter des Verwalters, ein belangloser Mensch von bedrückender Schlichtheit, hat den Lehrer Semjon Semjonowitsch Medwedenko geheiratet, den sie nicht liebt und den sie bald zu fliehen beginnt. Medwedenko indes liebt sie mit jeder Faser seines erbärmlichen Daseins. In dieser Situation reisen die Arkadina und Trigorin an. Auch Nina, die nach der Affäre mit Trigorin ihr Kind verloren hat und zu einer Provinzschauspielerin mutiert ist, hält sich in der nahegelegenen Stadt auf. Nach zwei Jahren kann konstatiert werden, dass kein Konflikt gelöst ist, dass keine Existenz sich in irgendeiner Weise zum Besseren entwickelt hat.
Tschechows Stücke gehen zu Herzen; es ist seit gut einem Jahrhundert großes Gefühlstheater. Doch wurden Tschechows Stücke tatsächlich im Sinn des Autors auf die Bühne gebracht und entsprechend eingerichtet? Diese Frage wirft Alvis Hermanis mit seiner Inszenierung am Cuvilliéstheater auf und er gibt eine erstaunliche Antwort, deren Umfang erst richtig verstanden wird, wenn man Tschechows Kommentar zu der Aufführung Stanislawskis im Programmheft liest. Dort steht geschrieben: „Sie (Serebrow – Anm. W.B.) sagen, Sie hätten in den Aufführungen meiner Stücke geweint … Sie sind nicht der einzige … aber dafür habe ich sie doch nicht geschrieben. Stanislawski hat sie so rührselig gemacht. Ich wollte etwas ganz anderes. Ich wollte den Menschen nur ehrlich sagen: „Schaut euch doch an. Schaut wie schlecht und langweilig ihr lebt! Das wichtigste ist, dass die Menschen das begreifen und sobald sie es begreifen, werden sie sich ein anderes, besseres Leben schaffen. (…) Was gibt es da zu weinen?“
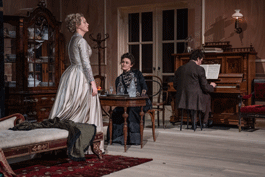 |
||
|
Katharina Pichler, Anna Graenzer, Marcel Heuperman © Federico Pedrotti |
Könnte es sein, dass ein Großteil der Inszenierungstradition nicht dem Willen Tschechows gefolgt ist, sondern dem eigenen Wunsch zu gefallen? Es ist natürlich eine rhetorische Frage, der ein Quäntchen oder mehr Wahrheit innewohnt. Immerhin kann man Alvis Hermanis nicht vorwerfen, er habe in den freien Raum hinein fantasiert. Er hat ganz augenscheinlich auf Tschechows literarische Notizen (entstanden zwischen 1892-1895) zurückgegriffen, die wegen ihrer Prägnanz und Treffsicherheit erstaunen. So definiert Tschechow Kostjas Kunstauffassung wie folgt: „Etwas Neues und Künstlerisches zu proklamieren kommt den Naiven und Reinen zu, aber ihr Routiniers (Arkadina und Trigorin - Anm. W.B.) habt die Macht in der Kunst in eure Hände genommen und betrachtet nur das als legal, was ihr tut, und das übrige würgt ihr ab.“ Das ist ein kulturpolitisches Statement. Kostjas Kunstauffassung, ebenso in den Notizen niedergelegt, übernahm Alvis Hermanis in seine Inszenierung: „Man muss das Leben nicht so darstellen, wie es ist, und nicht so, wie es sein soll, sondern so, wie es im Traum ist.“
Alvis Hermanis inszenierte, wie er glaubte (oder weiß), dass es im Sinne Tschechows sei. Und der Preis? Heraus kam eine Inszenierung von drei Stunden reiner Spielzeit (eine Pause), die weitestgehend frei von theatralischen Höhepunkten war, in der kein Darsteller sich spielerisch über den anderen erheben konnte und die auf bedrückende Weise von der Qual der einzelnen Figuren zeugte. Kostja, besetzt mit dem wunderbaren Marcel Heuperman, war frei von messianischer Kunstbeflissenheit, brennend zwar für die Dichtung, aber in tiefe Selbstzweifel verstrickt. Sein Leid resultierte nicht aus der fehlenden Anerkennung seiner künstlerischen Aktivitäten, sondern banaler Weise aus seinem (per se) kulturellen Ausgeschlossen sein. Derselben Enge kann auch die junge Mascha nicht entfliehen, die von Anbeginn schon um ihr Leben trauert, das eigentlich noch vor ihr liegt. Anna Graenzer spielte sie weitestgehend frei von Selbstmitleid. Allein, Zynismus und emotionale Erstarrung ließen sich nicht vermeiden.
Die tragischste Figur war indes eine Nebenrolle: der Lehrer Semjon Semjonowitsch Medwedenko. Tim Werths spielte ihn auf groteske Weise völlig verunstaltet. Das mutete zwar clownesk an, doch bald schon war klar, dass er von allen Figuren die elendste war. Sophie von Kessels Irina Nikolajewna Arkadina war nüchtern angelegt, weder chargierte sie in der Rolle der eitlen Diva, noch nahm sie sich zurück in der Figur der eigenen Dümmlichkeit. Ganz ähnlich Michele Cuciuffos Schriftsteller Boris Alexejewitsch Trigorin. Cuciuffo schuf eine Figur, die dem Ruhm gönnerhaft geringe Bedeutung beimaß, die ihr Licht sowohl/als auch nicht unter den Scheffel stellte, im Gegenzug aber spießig vom kleinen Glück des Angelns am See schwärmte. Eine Zusammenfassung des ganzen emotionalen Elends verkörperte in sehr unaufdringlicher und einnehmender Weise Kostjas Onkel, Pjotr Nikolajewitsch Sorin. René Dumont lieferte ein wunderbar schlüssiges Bild. Mathilde Bundschuhs Nina Michailowna Saretschnaja war von betörender Naivität vor dem (Sünden-) Fall und pathologisch anmutender Zerrissenheit nach ihrem Scheitern. Ihre Reise in die Bedeutungslosigkeit der russischen Provinz implizierte die unbehaglichsten Vorstellungen.
Die einzige Figur, die nicht als tragische begriffen wurde oder als solche nicht über die Rampe kam, war der Arzt Jewgenij Sergejewitsch Dorn. Thomas Huber spielte den properen Womanizer mit einiger Nonchalance. Er hatte sich seine Freiheit bewahrt, jedoch um den Preis der Bindungslosigkeit, ohne indes auf die holde Weiblichkeit zu verzichten. Für Polina Andrejewna (Katharina Pichler), Ehefrau des Gutsverwalters Schamrajew (Wolfram Rupperti) und Mutter Maschas, waren seine Avancen ein Hauch von großer, weiter Welt. In der nämlich war Dorn ein wenig herumgekommen.
Alvis Hermanis ist in München spätestens seit seiner Inszenierung von Maxim Gorkis „Wassa Schelesnowa“ an den Kammerspielen als Perfektionist in Ausstattungsfragen bekannt. Er schuf sich selbst in Zusammenarbeit mit Thilo Ullrich für seine Inszenierung ein perfektes bürgerliches Interieur in der Ausstattung des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Durch seine Detailversessenheit entstand eine zwingende Atmosphäre, in der auch die historischen Kostüme Kristīne Jurjāne bestens aufgingen. Es war durchaus eine Augenweide, ein so stimmiges historistisches Bild betrachten zu können, auch wenn in Theaterkreisen derartige Unternehmungen als „Rückfälle in das bürgerliche Operettentheater“ belächelt werden, ja, schlimmstenfalls sogar verschrien sind.
Alvis Hermanis war konsequent bei der Durchsetzung seiner Idee und seiner Vorstellung, wie Tschechowsches Theater aussehen sollte. Seine Arbeit darf und sollte unbedingt als wertvoll bezeichnet werden. Sie lieferte zudem einen erstaunlichen und berechtigten Beitrag zur Hinterfragung der Inszenierungstradition dieses Stückes, die durchaus schon Spuren von Verwahrlosung aufweist. Immerhin ist das Stück seit 45 Jahren rechtlich ungeschützt und dem Zugriff jedermanns ausgeliefert. Da ist es sehr honorig, wenn sich einer darum bemüht, nach so vielen Jahren dem Autor gerecht werden zu wollen. Nun hat das Prädikat „Wertvoll“ immer auch einen Beigeschmack, denn nicht selten bedeutet es anspruchsvoll und schwierig. Aber es lohnt sich, wie auch im vorliegenden Fall, fast immer.
Wolf Banitzki
Die Möwe
von Anton Tschechow
Deutsch von Angela Schanelec
| Sophie von Kessel, Marcel Heuperman, René Dumont, Mathilde Bundschuh, Wolfram Rupperti, Katharina Pichler, Anna Graenzer, Michele Cuciuffo, Thomas Huber, Tim Werths Regie/Bühne: Alvis Hermanis |