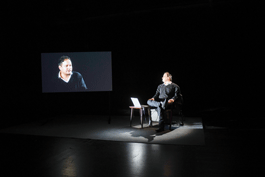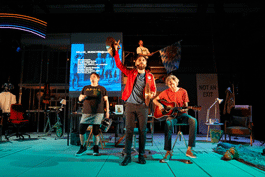Werkraum Hellas München von Anestis Azas und Prodromos Tsinikoris
Heitere Ambivalenz
Hinter dem Projekt „Hellas München“ verbirgt sich ein Dokumentartheaterabend, in dem vier junge Griechen Rückschau halten auf das Thema Einwanderung von Griechen nach München im Allgemeinen und ihren eigenen Schicksalen als Zuwanderer im Besonderen. Außer Regisseur Prodromos Tsinikoris (Co-Regisseur Anestis Azas) waren die Darsteller Laien, griechische Mitbürger aus München. Der Abend begann mit einer Rückschau, und zwar in die Zeit der beinahe neun Jahre dauernden Befreiungskriege der Griechen gegen das türkische Joch, die ihr Ende im September 1829 fanden und in denen auch prominente Europäer wie Lord Byron ihr Leben ließen.
Von der starken Verbundenheit der Wittelsbacher Landesführung, insbesondere Ludwig I., zeugen noch heute die Propyläen am Münchner Königsplatz als Denkmal für diese Befreiungskriege. Um die Errichtung eines neuen, pro-westlichen Staatsgebildes in Griechenland zu gewährleisten, einigten sich die europäischen Großmächte auf den noch minderjährigen bayerischen Prinzen Otto I., Ludwigs Sohn, als neuen griechischen Monarchen. Er verstand es zwar, den Ausbau der Infrastruktur, des Schulwesens und einer effizienten Verwaltung voranzutreiben, doch den breiten Massen blieben die wichtigsten Grundrechte verwehrt. Erst durch einen Militärputsch 1843, der sich zu einem Volksaufstand ausweitet, bekam das griechische Volk eine Verfassung. Die „Bavarokratie“ wie die Griechen die neoabsolutistische Herrschaft Ottos spöttisch nannten, war keineswegs nur segensreich und bereits unter seiner Herrschaft musste der Staatsbankrott mehrfach durch Finanzspritzen, z.B. aus Bayern, abgewendet werden. Ein zweiter Volksaufstand 1862 beendete Ottos Herrschaft und zwang ihn ins Exil nach Bamberg. Diese Ausführungen wurden gemacht, um einer Verklärung der deutsch-griechischen Geschichte vorzubeugen.
Der Abend „Hellas München“ berichtete davon, dass begabte Griechen um 1830 auf Einladung Ludwig I. nach München kamen, um zu studieren. Sie sollten als Eliten tatkräftig am Aufbau Griechenlands helfen. Allein, sie gingen nicht zurück. Sie blieben und assimilierten sich. In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es eine erneute Einwanderungswelle. Griechische Bürger, Männer wie Frauen, kamen zum einen, um der ökonomischen Not, zum anderen aber auch um der Verfolgung durch das „Obristensystem“ in Griechenland, einer von 1967 bis 1974 andauernden Militärdiktatur, zu entgehen. Telefoninterviews mit ehemaligen Gastarbeitern und Verwandten wurden eingespielt. Allen Interviews war die Sehnsucht nach der Heimat eigen, und wenn ein Teil der Befragten versicherte, zwei Heimaten zu haben, kehrte ein anderer Teil selbst nach fast einem halben Jahrhundert in die alte Heimat zurück. Vierzig Jahre und mehr haben sie in Deutschland malocht und wesentlich am Entstehen des Wohlstands im Land partizipiert. Nun steht wieder eine Generation Griechen vor der Tür des deutschen Reichtums und begehrt Einlass. Sie gehören zur Schicht der „Working Poor“, hochqualifiziert und willig, doch chancenlos. Tränenreich waren die Abschiede, keinesfalls larmoyant die Berichte über die Ankunft. Vier Vertreter dieser Generation gaben Auskunft.
| |
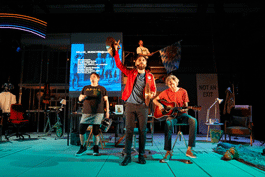 |
|
| |
Hintergrund: Valantis Beinoglou, Vordergrund: Aikaterini Softs, Prodromos Tsinikoris, Angelos Georgiadis
© Judith Buss
|
|
Die 1984 in Thessaloniki geborene Aikaterini Softsi ist von Beruf Architektin. Doch in Griechenland wird auch wegen der von Deutschland, insbesondere vom ehemaligen Finanzminister Dr. Schäuble, die Deutschen küren ihn seit vielen Monaten in Folge zum beliebtesten Politiker, geforderten Sparmaßnahmen im Staatshaushalt, nicht mehr gebaut. Der Versuch, ein Restaurant zu betreiben, scheiterte, denn Freunden und anderen Gästen ging langsam das Geld aus für den „Luxus“ eines Restaurantbesuches. Die junge Frau ist eine Kämpferin und in ihrem ersten Job spülte sie 50 Tage lang Teller für einen Hungerlohn, ehe sie an ihrem ersten freien Tag München erkunden durfte. Der erste Schritt in die Freiheit, ihr Arbeitgeber hatte dringend abgeraten, war die (zu ihrer Verwunderung) reibungslose Eröffnung eines eigenen Kontos. Heute hat sie in der Belegschaft des Restaurants, in dem sie mit Begeisterung kocht, eine echte Familie gefunden.
Angelos Georgiadis hat monatelang versucht, in Deutschland Fuß zu fassen. Dabei könnte man meinen, dass das nicht schwer sein sollte als studierter Tourismus-Manager im Land der Reiseweltmeister. Und gerade als ihm sein karges Budget auszugehen und ihn die Verzweiflung zu übermannen drohte, entdeckte er in der Sonnenstraße den Firmennamen “Attika Reisen“. Was hatte er nach zahllosen Bewerbungen und ebenso vielen negativen Bescheiden schon zu verlieren? Er stellte sich vor und ist heute Mitglied der Accountig-Abteilung, glücklicher Familienvater und als Musiker Mitglied der Bands „The Eagle Trail“ und „Mpouat“, der auch seine eigene Musik komponiert.
Valantis Beinoglou stammt ebenfalls aus Thessaloniki und ist ein Jahr jünger als seine Landsfrau Aikaterini. Der studierte IT-Spezialist war einen ähnlich steinigen Weg gegangen, ehe er endlich einen vermutlich recht gut bezahlten, berufsnahen Job bei der Firma „eurotrade“ am Münchner Flughafen fand. Die Tatsache, dass keiner von ihnen über sein Einkommen sprach, wurde als eine echt deutsche Tugend ausgemacht, die sie sich schon zu Eigen gemacht haben. Der Deutsche spricht nicht über Geld.
Das war nur einer der zahlreichen Unterschiede, die an diesem Abend erkennbar wurden. Doch diese zu überwinden scheint möglich. Die drei Protagonisten machten es vor, und zwar mit deutlich mehr Komik, als es die Deutschen tun würden oder könnten. Prodromos Tsinikoris, „dessen Schicksal den umgekehrten Weg gegangen war“, in Deutschland geboren und nun häufig in Griechenland als gut bestallter Theatermacher arbeitend, moderierte auf sehr persönliche und humorige Weise. Dabei wurde nicht für ein Publikum, sondern mit einem Publikum gespielt. Vermutlich waren die einzigen deutschstämmigen Besucher die mit den Pressemappen auf dem Schoß. Man spürte der Veranstaltung an, wie sehr sich die griechische Community, übrigens die größte in ganz Deutschland, in dieser Performance wiederfand. Es war übrigens eine Veranstaltung, die Live ins Internet übertragen wurde und vermutlich von sehr vielen Griechen, nicht nur in Deutschland gesehen wurde.
Dem deutschen Zuschauer wurde einmal mehr bewusst, wie wichtig und wie wertvoll uns die griechisch stämmigen Mitbürger geworden sind. Damit ist nicht der „Griechische Wein …“ – das musikalische „warm up“, bevor sich der Vorhang, in diesem die Folie zum Spiel lüftete, gemeint, sondern ihre Fähigkeit zur Selbstironie, ihre mediterrane Sinnlichkeit, ihr Temperament. Und wenn sie sich am Ende mit einem Lied verabschiedeten, in dem sie die Jugend Griechenlands zum Kommen aufforderten, ihnen zugleich einen satten Burnout und das Erlebnis, seine Zigarette bei Minusgraden vor der Tür des Restaurants zu rauchen versprachen, erlebte man eine seltene heitere Ambivalenz, über die man herzlich lachen konnte.
Wolf Banitzki
Hellas München
ein Projekt von Anestis Azas und Prodromos Tsinikoris
Prodromos Tsinikoris und den Münchner BürgerInnen Valantis Beinoglou, Angelos Georgiadis, Aikaterini Softsi
Inszenierung: Prodromos Tsinikoris und Anestis Azas
|
Kammerspiele Werkraum Nachts, als die Sonne für mich schien von Uisenma Borchu
Der schale Geschmack der Vergeblichkeit
Mit „Schau mich nicht so an“ debütierte Uisenma Borchu als Filmregisseurin und wurde dafür 2016 mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. Sie kam nun dem Angebot nach, ein Projekt auf der Bühne (Werkraum) der Münchner Kammerspiele zu realisieren. Es scheint beinahe unausweichlich zu sein, dass die Künstler dieser Generation (Uisenma Borchu wurde 1984 in Ulan Bator geboren.) als allererstes sich selbst inszenieren und ihre eigene Geschichte erzählen. Immerhin hat Uisenma Borchu eine Geschichte, die zwei Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer begann. Da nämlich reiste sie gemeinsam mit ihrer Familie aus der Mongolei in die DDR ein. In der DDR galt das von der Partei verordnete Prinzip der Völkerfreundschaft und so wurden die Genossen aus anderen Ländern offiziell stets sehr freundlich empfangen.
Selbstredend gab es in der Bevölkerung der DDR eine Vielzahl von Ressentiments, zu denen die natürliche Angst vor und Abneigung gegen das vermeintlich „Fremde“ ebenso gehörte, wie der Neid, denn es gab auch Zuwanderer, die zumeist nur temporär in der DDR blieben, die mit ihren Reisedokumenten in das „nichtsozialistische“ Ausland reisen konnten, wie zum Beispiel Studenten aus Mali, Arbeiter aus Jugoslawien oder Kommunisten aus Indien.
Es war ebenso natürlich, dass diese Ressentiments nach dem Mauerfall offen ausbrachen und zu Ausschreitungen wie denen in Rostock-Lichtenhagen oder Schwedt an der Oder führten. Soziologen und Historiker hätten davor warnen können, haben es aber zumeist nicht getan, weil sie sofort als „Nestbeschmutzer“ abgetan wurden. Folglich glaubte man willig an die Verheißungen der Politik und an die Vision von den „blühenden Landschaften“. Uisenma Borchu schlug in dieser Zeit ein kalter Wind ins Gesicht, was für ein Kind natürlich um ein Vielfaches beängstigender und verunsichernder war, als für einen erwachsenen Menschen mit Lebenserfahrungen. Erster Ansprechpartner war der Vater, der ihr gesunde Selbstbehauptung zu vermitteln suchte. Die Konflikte waren damit aber nicht aus der Welt zu schaffen.
| |
 |
|
| |
Uisenma Borchu, Lea Johanna Geszti
© Josef Beyer
|
|
Mit ihrer Geschichte erzählte Uisenma Borchu keine neue und sie tat es auch nicht auf besonders interessant oder fesselnde Weise. Die von ihr verfassten Texte waren spröde, nicht selten plakativ und gelegentlich poetisch, wobei die Poesie auf recht verlorenem Posten stand. Die Zweidimensionalität war nicht förderlich, tiefere Einsichten zu transportieren oder Aufklärung zu leisten. Vielmehr geriet vieles sehr eitel, wenn Uisenma Borchu mit ungeschulter Stimme, dilettantischen Texten, die Hände tief in den Hosentaschen vergraben, über das Mikroport hauchend, betont nachdrücklich über die Bühne schwebend, ihre ureigene Geschichte erzählte, die ohne Frage eine unschöne, aber doch wahrlich keine seltene und damit exemplarische war. Es war nicht mehr als eine weitere Wortmeldung zum Thema Ausländerfeindlichkeit, ein Thema, das momentan sämtliche andere Themen stark in den Hintergrund treten lässt und das eigentlich nur einer Gruppe unserer Gesellschaft in die Hände spielt, nämlich den Ausländerfeinden und deren Mitläufer. Es sei noch einmal mit Nachdruck darauf verwiesen, dass in Deutschland 87 % der Wahlbürger eindeutig Flagge gezeigt haben und sich zur Demokratie bekannten.
Zumindest ästhetisch war ein deutliches gestalterisches Bemühen zu erkennen, denn Uisenma Borchu, die, wie bereits erwähnt, als Erzählerin und als heutige Uisenma Borchu durchgängig auf der Bühne war, wurde gleichsam lebendig und raumgreifend von Lea Johanna Geszti als Schulmädchen Uisenma gespielt, die allerdings den vielen Anfeindungen sehr introvertiert und defensiv begegnete, vermutlich, weil ihr wenig Argumentatives an die Hand gegeben war. Es blieb überwiegend bei Befindlichkeiten. Wenn sie in ihrem kindlichen Drang emotional dekompensierte, im positiven, wie im negativen, dann zumeist an die Adresse des Vaters gerichtet. Auch der war doppelt auf der Bühne, in Person des Malers Borchu Bawaa und in der Person Christian Löbers, der den Vater der späten 80er und frühen 90er Jahre spielte. Uisenma Borchus Ansatz war es, dem Vater über seine Malereien auf der Bühne Statements zu seinem damaligen Seelenleben abzuringen. So entstand in den 70 Minuten ein großes Gemälde zum Thema „Wende“. Christian Löber, ein Schauspieler mit enormer Präsenz und magischem Spielvermögen, wirkte nicht selten, als würde er improvisieren. Das erweckte den Anschein, dass er von der Regie nicht hinreichend aufgeklärt worden war, in welche Richtung sich die Figur letztlich entwickeln sollte.
Sehr befremdlich wirkte die Darstellung der Lehrerin, die einzige gesellschaftliche Person, der die mongolische Familie in der deutschen Realität in der Aufführung gegenübergestellt wurde. Araba Walton, selbst farbig und eine sehr attraktive Frau, fiel die Rolle zu, den „hässlichen Deutschen“ zu geben, der sich beispielsweise darüber beschwerte, dass viele Landsleute arbeitslos seien, während die Ausländer Festanstellungen hatten. Die teilweise kryptischen Texte dieser Figur erzeugten eine Unschärfe, hinter der sich latent faschistoides Gedankengut, aber auch sehnsüchtige Verunsicherung und Verzweiflung verbergen konnte. Diese Unschärfe blieb bis zum letzten Augenblick und war möglicherweise sogar gewollt. Ahnungen und Spekulationen hielte das Stück offen und vermieden ein letztes Urteil.
Diese inhaltliche Offenlassung deckte sich mit der in der Werbung zum Stück formulierten Fragen: „Ist die Zeit, ist die Vergangenheit wieder einzuholen? Und kann man dadurch dem Rätsel, wer man ist, auf die Spur kommen?“ Auf Antworten wartete man vergeblich und ohne Antworten blieben auch deutliche Haltungen außen vor. Schade, denn der schale Geschmack der Vergeblichkeit war das letzte Gefühl beim Verlassen des Werkraums.
Wolf Banitzki
Nachts, als die Sonne für mich schien
von Uisenma Borchu
Araba Walton, Borchu Bawaa, Christian Löber, Lea Johanna Geszti, Uisenma Borchu
Regie: Uisenma Borchu
|