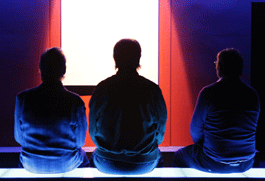Metropol Theater Woyzeck nach Georg Büchner von Tom Waits/Kathleen Brennan/Robert Wilson
Das Tier
Ein großer, mit weißem Stoff verhängter Würfel nahm die Bühne des Metropol Theaters ein. Sound. Der Ausrufer erschien im Scheinwerferlicht. Zylinder, weißes Gesicht, schwarze Brauen und grauer Frack, „The higher the monkey can climb …“, sang sie. Licht fiel auf den Würfel, eine Mücke, die sie geschickt mit dem Hut fing, dann der Schatten eines Esels, er wackelt mit den Ohren, dem Schwanz. „…nothing kind about mankind…“. Der Ausrufer schwang den Stock, bewegte den Vorhang, zog ihn auf den mit schwarzen Plastiksäcken ausgelegten Bühnenboden. Ein großer wandelbarer Stahlkäfig mit Öffnungen, Klappen und einer Querstange als Sitzplatz beherrschte das Bild. In ihm standen nun Franz, Marie, der Hauptmann, der Doktor, der Tambourmajor und Andres – ihre Körper hatten den Schatten geworfen.
Woyzeck, ein einfacher Soldat, muss Geld verdienen für Marie und für das gemeinsame Kind. Er tut dies im Rahmen seiner Möglichkeiten, rasiert den Hauptmann, dient dem Doktor als Versuchs“tier“, frisst nur Erbsen. Marie begegnet in der Zwischenzeit dem Tambourmajor, der ihr goldene Ohrringe schenkt und laut darüber nachdenkt mit ihr weitere Tambourmajore zu zeugen. Woyzeck macht sich Gedanken über das Leben und das Tun der Menschen, kommt dem Wahn nahe, dem eigenen und dem der anderen. Als er von Maries Untreue erfährt, bleibt nur eine Konsequenz.
Die Armee, die Wissenschaft, die Fortpflanzung und das Vergnügen daran bilden die äußeren Schwerpunkte für das, die Abgründe der armen geknechteten Kreatur ausleuchtende Werk. „Langsam, Woyzeck, langsam; eins nach dem andern! …“, stellt der Hauptmann fest, der sich den Tag zu füllen sucht. Franz kann sich derlei nicht leisten: „… Sehn Sie: wir gemeine Leut, das hat keine Tugend, es kommt nur so die Natur; …“ Jochen Schölch betonte in seiner Inszenierung die tierische Natur des Menschen und seine verzweifelten Versuche, mit dieser zu leben. In einer Gesellschaft, deren Menschen um Gleichgewicht ringen, zumindest vorgeben dies zu tun, und in der diese tierischen Verhaltensweisen von einer starren scheinbar allgewaltigen Vernunft drangsaliert werden, ist dies ein zweifelsohne sinnfälliger Ansatz.
| |
 |
|
| |
Georg Stephan, Fabian Stromberger, Agnes Kiyomi Decker, Sebastian Fritz, Benedikt Zimmermann, Evgenija A. Rykova
© Hilda Lobinger
|
|
Im dunklen Hintergrund saßen die Musiker und erfüllten mit ihrem virtuosen Spiel den Raum. Kräftig rockig, sentimental oder melodiös variierten sie und zogen den Zuschauer in den Bann brillant zu Hörgenuss erweckten Tom-Waits-Sounds. Der Ausrufer umschlich den Käfig wie ein Raubtier auf Beutesuche, sang, kommentierte, griff ein. Evgenija A. Rykova gab diese Figur herausfordernd, langbeinig, lebendig. Sie traf stets die richtige Tonart, die passende Geste. Präzise imitierte sie Marie, die im Spiegel ihr Gesicht und die neuen Ohrringe betrachtete, „… the face forgives the mirror …“. Im Käfig: Woyzeck, gutmütig, leicht und leidensfähig gegeben von Fabian Stromberger, spiegelte er die Situationen durch seine Haltung, kletterte verzweifelt, schlug mit dem Kopf gegen das Gitter, klammerte sich an Marie oder den Käfig. Marie, Agnes Kiyomi Deckers Spiel glich dem einer Puppe, ein modernes Mädchen, dessen Augen Halt suchend durch den Raum streiften, das unmerklich kokett die Schaukel mit dem Tambourmajor teilte. Tambourmajor Sebastian Fritz ließ mit „Ich bin ein Mann“ und dem Griff zur Flasche „Ich wollte die Welt wär Schnaps…“ keinen Zweifel an seiner Rolle aufkommen. Dem Hauptmann, Georg Stephan, gelang die Veranschaulichung von Langsamkeit. Ruhig, behäbig füllte er den Käfig, kletterte er die Wand zur Sitzstange hoch, um sich mit dem Doktor zu unterhalten. Der Doktor, Benedikt Zimmermann, war ein pfiffiger, listiger und wendiger; rücksichtslos auf der Suche nach Anerkennung. Andres, Lilly Grooper, stellte den Gegenpart vor. Ruhig zurückhaltend brachte sie den treuen Begleiter und Freund Woyzecks in den Käfig. Ihr Stottern war meisterhaft und die abschließende Erzählung vom verlassenen weinenden Kind ergreifend. Die Inszenierung zeichnete eine äußerst lebhafte und körperlich aktive Darstellung aus. Die Charaktere waren sorgfältig umgelegt auf die Körpersprache, in der die Darsteller agierten, die Gitterwände hochkletterten, sprachen, sich bewegten. Die Bühnenkünstler aus der Münchner Theaterakademie spielten mit großer Freude und Einsatz. Die Gesangseinlagen gelangen bravourös und mitreißend.
Tom Waits Songs machen eine weitere Ebene des Fragmentes von Georg Büchner aus dem Jahre 1837 erfahrbar. Stand bislang (bis zur UA des >art-musical< 2002 in Kopenhagen) der Text im Vordergrund, die Bilder, so kommt durch die Musik zusätzlich Bewegung in die Gefühlswelt. Der unverkennbare Sound, die Mischung aus sensibler Romantik und aggressiven Rhythmen, die verbundenen Elemente von Country, Classics, Blues, Pop u.a. berühren, nimmt den Zuhörer ein. Die Lyrics von Kathleen Brennan und Tom Waits bringen neue Perspektiven ins Spiel. Die Situationen werden auch physisch erfahrbarer, was zweifelsohne eine Bereicherung darstellt. Die minimalistische Konzeption Robert Wilsons eröffnet die Tiefe einzelner Schlüsselszenen, ohne den Zusammenhang zu verlieren. Die Lebenswahrheiten und die lebendige Inszenierung von Jochen Schölch schufen zusätzlich Gewicht, das auf die eine oder andere Art von jedem Betrachter erfahren wurde. Wenn sich herausragende Künstler zu einem Werk zusammentun, so kann dies nur einen Höhepunkt bedeuten.
C.M.Meier
Woyzeck
nach dem Stück von Georg Büchner
Musik und Liedtexte von Tom Waits und Kathleen Brennan / Konzept Robert Wilson
Textfassung von Ann-Christin Rommen/Wolfgang Wiens
|
Fabian Stromberger, Agnes Kiyomi Decker, Georg Stephan, Benedikt Zimmermann, Sebastian Fritz, Lilly Gropper, Evgenija A. Rykova
Musik: F. Rauchbauer, Andreas Lenz v. Ungern-Sternberg, Maria Friedrich, Christoph Sauer, Steffen Schmitt, Christoph Delker
Regie: Jochen Schölch
|
Metropol Theater Kunst von Yasmina Reza
Männer
Serge kann es sich als Mediziner leisten, 200 000 für ein Bild auszugeben. Das heißt, er ist nicht reich, aber doch wohlhabend. Nein, eigentlich kann er es sich nicht leisten und er gesteht, dass er pleite ist. Nun gut, ein Bild ist eine Wertanlage und er könnte es für 220 000 sofort wieder an den Galeristen losschlagen, der es nur nicht selbst gekauft hat, weil er die Dynamik des Marktes nicht beeinflussen wollte. Was, wenn das Bild weiß ist, mit einigen weißen Streifen und einer weißen Linie. Marc ist entsetzt über die dümmliche Naivität des Freundes und nennt es „weiße Scheiße“, was Serge im tiefsten Innern verletzt. Er sieht deutlich die „starke Präsenz des Abwesenden“, erfühlt „die Vibrationen, zumindest bei Tageslicht“. Marc eilt zu Yvan, der in Hochzeitsvorbereitungen steckt, und erzählt ihm von Serge und seiner Anschaffung. Als Yvan das Bild betrachtet, er wusste ja was ihn erwartet, signalisiert er Zustimmung. Jetzt treffen allen drei aufeinander, sie hatten sich zum Kino verabredet, und die Männerfreundschaft schmilzt dahin wie ein Sorbet in der Sonne. Marc meint, das wäre nie passiert, hätte man, wie in der Vergangenheit erfolgreich praktiziert, seinem Urteil, selbstredend das einzig richtige, vertraut. Yvan versteht das alles nicht, hat eigentlich ganz andere Probleme, denn er ist in eine unselige Mesalliance geschlittert und weiß nicht, wie er sich retten kann. Marc nennt ihn wegen seiner Zustimmung zum Bild einen „servilen Speichellecker“. Serge jammert über die Ignoranz der Freunde, über ihre Unfähigkeit, in künstlerischen Kategorien zu denken und zu empfinden. Am Ende, und das ist eine wunderbare Eigenschaft des Stückes, bringt eben diese „weiße Sch...“ die Freunde über eine Schweizer Kuhgallenseife wieder zusammen.
Autorin Yasmina Reza bringt den Mythos Männerfreundschaft zwar ins Wanken, doch sie denunziert ihn nicht wirklich. Es gibt ein versöhnliches Ende. Ebenso wenig verrät die Autorin die Kunst. Man mag über das Bild denken, was man will, Frau Reza stellt es zur Diskussion und es kommen durchaus überzeugende Argumente dafür ans Licht, dass es sich tatsächlich um Kunst handelt. Natürlich geht es in dem Stück gleichen Namens gar nicht um Kunst. Im Grunde ist das Bild ja nur Katalysator für die Reaktionen, die zwischen den Männern ablaufen, Reaktionen, die längst überfällig sind und nur aufgestaut waren. Dennoch geht Frau Reza sehr sensibel mit dem Thema Kunst um.
Serge ist nach seiner Scheidung in einer Sinnkrise und kompensiert diese mit einer ästhetischen Neuausrichtung. Yvan wird zunehmend deutlicher, dass er sich um die Sicherheit im Alter schlichtweg verkauft hat, und Marc, ein Mann von naturwissenschaftlicher Nüchternheit, nimmt seit kurzem homöopathische Beruhungsmittel. Wenn das kein Zeichen ist!
| |
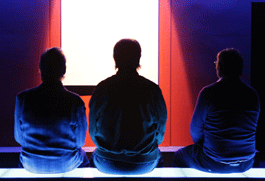 |
|
| |
© Hilda Lobinger
|
|
Thomas Flachs Bühne ist für Metropoltheaterverhältnisse geradezu elegant. Im Vordergrund befindet sich eine fixe, von innen beleuchtete Bank, im Hintergrund eine Rote Wand mit zwei Türöffnungen links und rechts und in der Mitte ein drehbarer Abschnitt. Je nach sichtbarer Fläche die entweder das weiße Bild, eine Ansicht einer französischen Landschaft im flämischen Stil trägt oder leer bleibt, verändert sich der Ort.
Es waren die Monologe, einen atemberaubenden über den Streit der Familienmütter hielt Werner Haindl als entnervter Yvan (Szenenapplaus!), und die Dialoge zwischen den Männern, die sich so facettenreich gestalteten, dass absolut keine Längen aufkommen konnten. Die Schauspieler brillierten in Wort und Gestus, wobei Regisseur Jochen Schölch ausschließlich der Psychologie der Vorgänge und der Personen folgte. Selbst wenn gelegentlich überzeichnet wurde, blieben die Argumente glaubhaft und lebensecht.
Weder Autorin Yasmina Reza noch Regisseur Jochen Schölch kommentierten die Figuren. Regisseur Schölch ließ sie sein und vertraute auf die darstellerische Kraft der Akteure. Matthias Grundig dominierte als Marc den Abend. Schließlich hatte er als Pragmatiker und Desillusionist auch die ‚unkultivierteste’ und damit aufdringlichste Rolle. Rüdiger Hacker und Werner Haindl hielten sich tapfer, denn es war ihre Rolle im Stück, sich gegen Marc zu behaupten. Rüdiger Hacker als feinsinniger und hochkultivierter Ästhet tat das denn auch recht lautstark, als die Anfechtungen zu rüde wurde. Es wurde nicht mit Bösartigkeiten gespart. Auch Werner Haindl, der Opportunist, dessen Opportunismus eher aus Erschöpfung geboren war, kam irgendwann nicht um seine Selbstbehauptung herum. Und auf diesem zutiefst menschlichen Level trafen sie sich wieder und erneuerten ihre Freundschaft. Es war ein pointenreicher Abend, der unter Jochen Schölchs Regie zu einem geradezu perfekten komödiantischen Ereignis wurde.
Es war wohl kein Mann im Publikum, der sich nicht an der einen oder anderen Stelle ertappt fühlte und dem nicht seine eigenen Sünden einfielen. Vermutlich konnte das nur aus der Feder einer Frau kommen! Auch wenn man dabei recht wenig über Kunst erfuhr, über Männerfreundschaft wurde so ernsthaft nachgedacht, dass es erstaunlich komisch wurde. „Kunst“ ist eine weitere Erfolgsproduktion aus dem Hause „Metropol“, die sicherlich schon jetzt als heißer Tipp gehandelt wird.
Wolf Banitzki
Kunst
von Yasmina Reza
Matthias Grundig, Rüdiger Hacker, Werner Haindl
Regie: Jochen Schölch |