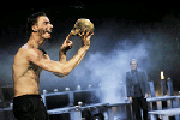Volksheater I Hired a Contract Killer nach Aki Kaurismäki
Lakonischer Großstadtblues
Wenn dereinst in fünfzig Jahren die Filmgeschichte geschrieben ist, werden die so genannten Blockbuster-Regisseure wie z.B. James Cameron nur marginal erwähnt werden. Sie werden in der Historie wegen ihrer technischen Innovationen und der überdimensionalen (un-menschlichen Formate) Eingang ins Erinnern finden. Ihre Geschichten, soweit es sich überhaupt um solche handelt, werden längst dem Vergessen anheim gefallen sein. Statt ihrer werden Namen aufgelistet wie Jim Jarmusch, Roberto Beghini, Emir Kusturica, Lars von Trier, Thomas Vinterberg und Aki Kaurismäki. Sie sind es, die die Entwicklung der Filmkunst befördert und nachhaltig durch ihre außergewöhnliche Ästhetik und ihre zutiefst menschlichen Geschichten beeinflusst haben. Es ist gar nicht verwunderlich, dass eben diese Männer sich untereinander gut kennen und sogar eng befreundet sind. Es gibt etwas, das sie in ihrem künstlerischen Anspruch eint, nämlich die konsequente Verweigerung gegenüber Hollywood und jeglichem Mainstream. Kluge Schauspieler wie Jonny Depp, Harvey Keitel, Forest Whitaker, Willem Dafoe und Isabella Rossellini haben das erkannt und dürften sich glücklich schätzen, gemeinsam mit diesen Regisseuren in die Annalen der Filmgeschichte einzugehen. Neben der außergewöhnlichen Ästhetik, sind es aber zuerst die grandiosen menschlichen Geschichten, die diese Regisseure erzählen und so verwundert es nicht, dass auch das Theater nach diesen Vorlagen greift.
Kaurismäkis “I Hired a Contract Killer” hat sich inzwischen in den Theaterspielplänen weltweit etabliert. Allein in München taucht dieses Stück bereits zum zweiten Mal in 10 Jahren auf (Metropoltheater 2001). Aber auch Lars von Triers „Dogville“ und „Manderlay“ und Thomas Vinterbergs „Fest“ (Metropoltheater und Volkstheater) wurden vom Publikum dankend angenommen. Warum? Diese Frage ist recht einfach zu beantworten: Diese Stücke haben uns etwas Substanzielles über das menschliche Wesen an sich und im besonderen mitzuteilen. Im Fall Kaurismäki liegt das im Wesentlichen an der radikalen Reduktion des Menschen im Kunstwerk auf sich selbst. Da bedarf es keinerlei Brimborium, um die Figuren interessant zu machen. Und eben diese Kargheit der Mittel ist das Wirkprinzip in den Filmen des Finnen. Ein Segen für das Theater? Gewiss, wenn da nicht die filmischen Vorlagen wären …
Regisseurin Bettina Bruinier gab vor, die filmische Vorlage nicht zu kennen. Das erwies sich vielleicht als die beste Voraussetzung, denn es ist ungleich schwerer, mit dem hochgradig suggestiven Film im Bewusstsein eine eigene Ästhetik zu entwickeln. Es war Bettina Bruiniers vierte Arbeit am Münchner Volkstheater und wie mit den drei vorangegangenen Inszenierungen enttäuschte sie auch mit der Kaurismäki-Adaption nicht.
Erzählt wird die Geschichte des gerade bei den Londoner Wasserwerken entlassenen Franzosen Henri Boulanger. Ohne jegliche soziale Kontakte und einzig auf seine Arbeit fokussiert, sieht er keinen Sinn mehr in seinem Leben. Seine Selbstmordversuche scheitern auf skurrile Weise und so entschließt er sich, einen Auftragsmörder zu engagieren, der ihn schnell und schmerzlos ins Jenseits befördern soll. Befreit von der eigenen Zwanghaftigkeit, wendet sich Henri, für den das Warten auf den Tod ziemlich nervenaufreibend ist, dem Leben und dem Whisky zu und begegnet der Liebe in der Person der Rosenverkäuferin Margaret. Nun, da das Dasein wieder einen Sinn hat, möchte er den Auftrag annullieren. Doch das gelingt nicht und so beginnt eine skurrile Flucht vor dem scheinbar Unausweichlichen. Allein, der Auftragmörder hat ein eigenes schwerwiegendes Problem und am Ende …
|

|
|
|
Pascal Fligg, Jean-Luc Bubert
© Arno Declair
|
|
Markus Kraner hatte auf der Bühne einen Großstadtdschungel geschaffen. Zahllose Häuserwürfel suggerierten eine gesichtslose Vorstadt, durch die sich auf ausgetretenen Pfaden das Leben schlängelte. Monotonie in Architektur und Bewegungsabläufen verkürzte das Leben auf ein reines sinn- und emotionsloses Funktionieren. Das Dasein, eigentlich ein Geschenk, war zur unerträglichen Last verkommen. Da der Text des gesamten Dramas wohl auf einer handvoll Seiten Platz hat, inszenierte Bettina Bruinier ein Bewegungstheater, über das atmosphärische Musik gelegt war. Oliver Urbanski schuf dafür einen facettenreichen lakonischen Großstadtblues, der live eingespielt wurde.
So grotesk der Kaurismäki-Film auch anmuten mag, Bettina Bruinier setzte ihm noch einmal die Krone auf. Die Darsteller agierten in skurril überzeichnenden Posen, entwickelten eine erstaunlich komische Körperlichkeit und sparten nicht mit gestischen Gags, ohne dabei vom Thema abzuweichen. Die kafkaeske Szenerie, die meisten Darsteller waren in grauenhaftem Grau bis Schwarz gewandet, wurde lediglich durch die Welt der Kriminellen und Halbkriminellen mit schrillen Farben zersetzt. (Kostüme: Justina Klimczyk)
Pascal Fligg gab einen Henri Boulanger, der selbst im Angesicht des bevorstehenden Todes nicht vergaß, an der Wohnungstür die Schuhe abzuputzen. Darsteller Fligg vermittelte glaubhaft, welche übermenschlichen Kräfte sein Henri aufwenden musste, um lebendig zu sein. Jean-Luc Buberts Auftragsmörder streifte schwarzgewandet mit rauer, komisch-furchteinflößender Stimme somnambul wie Fritz Langs „Der müde Tod“ durch die Szenerie. Barbara Romaner irrlichterte als Margaret mädchenhaft im Großstadtdschungel auf den Schwingen der Liebe herum, ganz und gar dem Prinzip Hoffnung verbunden. Am stärksten überzeichnet waren jedoch die Rollen Robin Sondermanns als Abteilungsleiter, Chef der Killer und am Ende als Betreiber eines französischen Fast-Food-Restaurants, was ja schon einen Widerspruch in sich darstellt.
Die erstaunliche ästhetische Botschaft Bettina Bruiniers bestand an diesem Abend ganz sicher auch in der Wirkung einer exzellenten Pausenchoreografie, im Innehalten und in der schlichten Präsenz von Figuren, die sich allein durch ihr sprachloses Dasein definierten. Dadurch entstand viel Raum für die Fantasie des Betrachters. Diese hochartifizielle und intelligente, szenisch immer wieder überraschende Inszenierung braucht den Vergleich mit dem Film nicht zu scheuen. Hier wurde nicht versucht zu kopieren, sondern eine bühnengerechte und eigenständige Erzählweise entwickelt.
Wolf Banitzki
I Hired a Contract Killer
nach dem Film von Aki Kaurismäki
Jean-Luc Bubert, Pascal Fligg, Barbara Romaner, Stefan Ruppe, Robin Sondermann, Xenia Tiling
Regie: Bettina Bruinier |
Volkstheater Hamlet von William Shakespeare
Hamlet robust
Die Ankündigung des „Hamlet“ elektrisiert die Theatergänger einer Stadt und die Erwartungen sind groß, zu groß, angesichts der Bedeutung dieses Stückes dramatischer Literatur, das seit vierhundert Jahren nicht nur mit dem künstlerischen Denken und Empfinden verschwägert ist. Das Stück ist in seiner Bedeutung längst über den Rang eines Kunstwerkes hinausgelangt. Und von Mal zu Mal wird die Bedeutung gesteigert, wird versucht, das Letzte, das es bei diesem Stück nie geben wird, herauszulocken. Dessen sollte sich jeder Regisseur, der den Versuch wagt, bewusst sein. „Hamlet“ ist kein Stück, mit dem man sich profilieren kann. Mit „Hamlet“ kann man nur bestehen oder durchfallen, denn der Shakespearesche Text wird immer größer sein als jeder Versuch, inszenatorisch über ihn hinaus zu gelangen.
So war es zu allen Zeiten immer ein probates, weil sicheres Mittel, den Text spielen zu lassen und nicht den Text zu spielen. Und genau das machte Regisseur Christian Stückl am Volkstheater nicht. Er reduzierte die Personage der tragenden Rollen um die Hälfte, ließ „Herren und Frauen vom Hofe, Offiziere, Soldaten, Schauspieler, Matrosen, Boten und anderes Gefolge“ gänzlich außen vor. Zugegeben, der Text reichte, würde man ihn sich selbst spielen lassen, problemlos für fünf Stunden. Was allerdings nicht bedeutet, dass das Spiel darum langatmig werden würde. Dazu ist das Drama zu komplex, zu vielschichtig und zu schön. Sei es drum, vermutlich hätte die Hingabebereitschaft der heutigen Zuschauer dafür nicht gereicht. In einer Welt der schnellen Bilder, der flinken Informationen, der sprechblasenhaften Kunstgenüsse scheint eine derartige Verkürzung angebracht, wenn denn das Stück erhalten bleibt.
War das auch wirklich zutreffend? Bereits beim Lesen des Programmheftes kommen Zweifel auf. Darin findet sich einzig ein Essay von H.D.F. Kitto, der überschrieben ist mit: „Das Problem des Hamlet“. Dieser Essay beschäftigt sich mit historischen Interpretationsansätzen, ausgedünstet in staubigen Studierzimmern, und setzt einen vermeintlich neuen dagegen. Es wird die Frage aufgeworfen, in wie weit Hamlet für seine Taten, es sterben immerhin acht Menschen, verantwortlich gemacht werden kann und muss. Diese typisch bürgerliche Sicht auf das „Problem“, wie es genannt wird, kann der Dimension des Stückes nicht gerecht werden. Es ist kein Stück über die Psyche eines Einzelnen und die daraus folgernden Katastrophen, sondern es ist einheitlich ein psychologisches und ein politisches Stück, zu allen Zeiten zeitgemäß. Schon die Bezeichnung des Plots als „Problem“ verrät einen Tunnelblick. Richtig wäre es, von der „Strategie des Hamlets“ zu sprechen. Das würde in jedem Fall den Raum für Interpretation entgrenzen.
Natürlich ist Hamlet in seiner Persönlichkeitsstruktur ebenso komplex und differenziert, wie die um ihn herum existierenden gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse. Um korrekt zu sein, sind Letztere es natürlich nicht ganz so, denn Politik ist nicht selten banal, durchschaubar und stupid. Aber genau diese Hamletsche Psyche macht das Drama so spannend und so potent. Wer in die Literaturgeschichte schaut, wird feststellen, dass das Prinzip des vermeintlichen Verrücktseins, verrückt aus der Realität und ihren Gesetzen, von mehr als einem Dichter benutzt wurde, um dem tatsächlichen Wahnsinn von Macht und Politik entgegen treten zu können. Wie anders, als eine Strategie des Aufbegehrens kann der Wahnsinn eines Don Quijote bezeichnet werden. Zugegeben, dessen Psyche trug pathologischen Züge, nicht aber die des Autors Miguel de Cervantes Saavedra. Oder betrachte man einmal den „Ulenspiegel“ von Charles de Coster, der übrigens in München das Licht der Welt erblickte. Die Macht dieses Tricks rettete vielleicht sogar Hölderlin das Leben, der, nachdem ihm Wahnsinn attestiert wurde und er dadurch einer Strafverfolgung entging, seiner Mutter mitteilte, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen. Nachgewiesener Maßen hatte Hölderlin gerade den „Hamlet“ gelesen. Was sollen also diesen Fragen nach der Verantwortung Hamlets für sein Tun? Sie berühren den Kern der Geschichte nur peripher. Im Übrigen, er bezahlt am Ende ohnehin mit dem Tod.
|

|

|
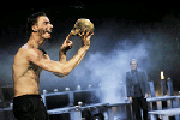
|
| Axel Röhrle, Justin Mühlenhardt, Jean-Luc Bubert, Ursula Burkhart, Eckhard Preuß, Barbara Romaner |
Michael Tregor, Friedrich Mücke
© Arno Declair
|
Friedrich Mücke, Robin Sondermann |
Die Geschichte beginnt mit der Heimkehr Hamlets aus dem „protestantischen“ Wittenberg ins dänische Helsingör. Sein Vater ist vom Bruder Claudius ermordet worden. Claudius hat sich damit in den Besitz des Thrones und der Königin gebracht, die mit ihm das Lager teilt. Der ruhelose Geist des Vater erscheint und beauftragt Hamlet mit der Aufklärung der Tat und mit der Rache. Hamlets Strategie besteht nun darin, die Dinge durch eine ausgefeilte Polemik in einem anderen Licht erscheinen zu lassen, wodurch er den Wahrheiten immer beängstigend nahe kommt, seine Gegner damit aufschreckt und sie zum Handeln zwingt. Hamlet tötet mit eigener Hand nur eine Person, den Oberkämmerer Polonius. Er hatte allerdings gehofft, den verhassten König Claudius zu treffen. Ophelia, Tochter von Polonius, wird von Hamlet, der sie aus dem Ränkespiel heraushalten will, in den Freitod getrieben. Das ruft den Bruder Laertes auf den Plan, der sich in seinem Rachedurst in die letzte Intrige von Claudius verstricken lässt, Hamlet tötet und selbst, wie auch die Königin Gertrud, dabei den Tod findet. Hamlet, schon sterbend, reißt Claudius mit sich. Doch nicht um den Tod dieser Menschen geht es im Stück, sondern um die Wahrheitsfindung und um den tragischen Weg bis zum Endpunkt.
Alu Walters Bühnenbild war nicht nur praktisch, es war ín seiner Schlichtheit gleichsam atmosphärisch und rhythmisch. Der Bühnenraum war begrenzt durch anthrazitfarbene Wände, die den Raum dennoch nicht bedrängten, nur begrenzten. Alles war sehr korrekt angelegt und es dominierte der rechte Winkel. Im Vordergrund zwei quadratische Wasserbecken, die rege bespielt, begangen und besprungen wurden, dazwischen Rasen, Flecken mit Muttererde und nach hinten aufsteigend hölzerne Terrassen. Das Arrangement war heutig, modern und in der Unverbindlichkeit ebenso zeitlos.
Regieberserker Christian Stückl, dessen Sache nicht unbedingt das psychologische Theater ist, präsentierte mit seinem Hamlet, robust und willensstark von Friedrich Mücke gespielt, keinen grüblerischen Prinzen von intellektueller Eindringlichkeit, der die Dinge mit dem ketzerischen Wort vorantrieb, dem eigentlichen Transportmittel, sondern durch provokante und aggressive Haltungen. Immer wieder parlierte Jean-Luc Bubert voller Verdruss als König Claudius, in Haltung und Gestus plausibel, über die Bühne und bemerkte: „Ich kann ihn nicht leiden.“ Das war begreiflich, denn Mückes Hamlet touchierte ihn, wo er nur konnte. Robin Sondermann, der den einzigen verlässlichen Freund Hamlets spielte, den Horatio, gab sich dezent, bisweilen sogar zärtlich. Als Hamlet ihm sterbend den Auftrag erteilte, die Geschichte von Mord, Verrat und Intrige in die Welt hinauszutragen, kamen Zweifel auf, ob er die Kraft dafür hätte. Barbara Romaner entsprach als Ophelia am ehesten der Vorstellung, die der Shakespearesche Text suggeriert. Jugendlich und hoffend eingangs, ging sie nachwandlerisch und ohne den Wahnsinn über Gebühr ausstellend in den Tod. Michael Tregor formte den Geist des getöteten Vaters zu einem wahrhaftigen Geist, bleich, gebrechlich und stimmlich wie aus dem Jenseits. Güldenstern und Rosenkranz (Axel Röhrle und Justin Mühlenhardt), geschmeidige Altersgenossen von Hamlet und opportunistische Genussmenschen, blieben in ihren Rollen ein wenig halbstark. Sie übernahmen allerdings auch den Part der Schauspieler im Stück „Mausefalle“, durch das König Claudius als Mörder überführt wurde. Darin boten Beide ein gelungenes Kabinettstück besten Volkstheaters, wie es Shakespeare wohl begrüßt hätte. Volkstheatralisch gab sich auch Eckhard Preuß als Polonius, bei Shakespeare ein wohltemperierter, pragmatisch handelnder Staatsmann und respektabler Herr. Preuß verwandelte diese Rolle in einen tuntenhaften Clown, der viel Applaus erntete. Zu Shakespeares Zeiten hatte man dafür die Rolle des „Pickelhering“.
Christian Stückl war bemüht, einen „Hamlet“ für Jedermann auf die Bühne zu bringen. Dabei blieb viel, vielleicht zu viel auf der Strecke, auch wenn seine Inszenierung flüssig, ansehnlich und gelegentlich auch lustig war. Allerdings ging letzteres Attribut auf Kosten der Feinsinnigkeit und Tiefe des Hamletkonfliktes und der Shakespearesprache, die immerhin hier und da aufblitzte. Das Publikum nahm es dankend an. Doch es ist Vorsicht geboten, wenn es darum geht, dem Publikum, das nie unterschätzt werden darf, zu weit entgegen zu kommen. Denn sonst endet es, wo es schon zu Shakespeares Zeiten nicht selten endete, als das Stück mit folgenden Worten auf einem Aushang angekündigt wurde: „Die erste Szene der Tragödie ist der bestrafte Brudermord. Hamlet hat den hinter der Tapete lauschenden Polonius im Zimmer der Königin niedergestochen. Der Geist schreitet über die Szene. Hamlet ist davon geloffen.“
Wolf Banitzki
Hamlet
von William Shakespeare
Jean-Luc Bubert, Ursula Maria Burkhart, Pascal Fligg, Friedrich Mücke, Justin Mühlenhardt, Barbara Romaner, Axel Röhrle, Robin Sondermann, Michael Tregor
Regie: Christian Stückl |