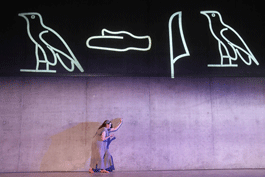Staatliches Museum Ägyptischer Kunst Aida von Giuseppe Verdi
Aida – kritisch betrachtet
Giuseppe Verdi (1813-1901) gilt als der bedeutendste italienische Opernkomponist des 19. Jahrhunderts, der nicht selten als Genie gehandelt wird. Doch auch Verdis Karriere holperte zu Beginn. Erst der ‚politische‘ Verdi begründete seine glänzende Musikerkarriere. Das erste Erfolgswerk war „Nabucco“ und spiegelte in der Geschichte des babylonischen Königs Nebukadnezar die nationalistischen Erhebungsbestrebungen der italienischen Teilstaaten gegen das Habsburgische Joch. Sätze wie „Flieg´, Gedanke, auf goldenen Schwingen“ elektrisierten das Publikum und wurde bald zu Leitmotiven des Widerstandes gegen Österreich. 1844 entfesselte Verdi mit seiner Oper „Ernani“ bei der Uraufführung im Teatro Fenice (Venedig) Stürme „vaterländischer Begeisterung“.
Seine Wirkmacht erzielte er durch einen kritischen Realismus, der vor der Darstellung des Hässlichen und der radikalen Durchführung seiner Themen bist zum Tod der Protagonisten nicht zurückschreckte. Auf den Vorwurf, in seiner Oper „Troubadour“ seien zu viele Tote, entgegnete Verdi: „Aber ist im Leben nicht schließlich alles Tod?“ Verdi, der seinen Librettisten nicht viele Freiheiten ließ und der nicht zuletzt auch sein eigener Dramaturg war, legte großen Wert auf die Hervorhebung des Allgemein-Menschlichen, wobei literarische Vorlagen, beispielweise von Shakespeare oder Schiller, nicht selten grenzwertige Verkürzungen erfuhren. Verdi erschien das realistischer. Und der Erfolg bei einem sehr großen Opernpublikum gab ihm Recht. Tatsächlich hatten seine Opern Dramaturgien und monumentale Bilder, wie man sie heute von filmischen Blockbustern kennt.
Nicht zuletzt basierte Verdis Erfolg auch auf der Tatsache, dass seine Themen Historie abhandelten. Dadurch gewann er Freiräume, in denen er die Konflikte hemmungslos bis zum Äußersten treiben konnte. Wahrheitstreue war dabei eher nebensächlich, wenn er nur fanalhaft seinen Freiheitsgedanken postulieren konnte. Der Ruf „Evviva Verdi“ war gemeinhin die Umschreibung für „Viva l´Italia!“, und als Victor Eamuel von Sardinien den Königsthron des endlich geeinten Italiens bestieg, sah das Volk darin neuerlich ein Symbol: V(ictor) E(manuele) R(e) d´I(talia) – Verdi. Nachdem Italien 1859 den Sieg über Österreich davongetragen hatte, mutierte der glühende Patriot Verdi zum Landmann, der sein Gut Sant´Agata bestellte und keinen politisch deutbaren Text mehr vertonte.
Genau diese drei Ansätze, die politische Radikalität, die ästhetische Monumentalität und historische Verklausulierung unterzogen Andreas Wiedermann und Ernst Bartmann in ihrer Inszenierung einer kritischen Betrachtung. Das Ergebnis reicht von erstaunlich bis erschreckend. Unter Einbeziehung der äußeren und inneren Umstände der Entstehung des Werks hinterfragten sie den tatsächlichen Wert dieser Oper. Das Ergebnis ist irritierend. Das Werk entstand im Auftrag des Khediven von Ägypten, Ismail Pascha. Dieser Mann war in Frankreich erzogen worden und strebte eine Erneuerung oder Modernisierung Ägyptens an, selbstredend nach europäischem Vorbild. Es sollte 1869 als Festoper zur Eröffnung des Suezkanals, ein bedeutendes Wahrzeichen des europäischen Kolonialismus, uraufgeführt werden.
Doch aus Zeitmangel lehnte Verdi zuerst ab. Nachdem er das Konzept, inspiriert von dem französischen Archäologen Auguste Mariette Bey, der die Oper später als seine ureigene Idee reklamierte, gelesen hatte, fing er schließlich doch Feuer und so wurde das Werk zwei Jahre später in einer legendären Inszenierung in Kairo zu Uraufführung gebracht. Die fiktive Geschichte um die äthiopische Königstochter Aida, Sklavin der Pharaonentochter Amneris, und ihrem Geliebten, dem ägyptischen Feldherren Radamis, kündet vor allem von einem hemmungslosen Nationalismus. Und der war bereits zur Uraufführung gewollt. Ismail Pascha wünschte ein Werk, das einem historischen Nationalismus huldigen und die Größe des Pharaonenreichs beschwören sollte. Und was wäre besser geeignet, die Gefühlswelt der Nationalisten in Wallung zu bringen, als eine Vertonung durch Verdi. Der leistete ganze Arbeit und das vornehmlich europäische oder frankophile Publikum war entzückt und hingerissen. Die Uraufführung ging als Weltereignis in die Geschichte ein.
| |
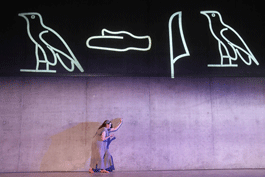 |
|
| |
Kristin Ebner |
|
Nationalismus hat immer eine wesentliche Grundeigenschaft, er preist die eigene Überlegenheit anderen Völkern gegenüber. So kommen die Äthiopier in Verdis Oper ausgesprochen schlecht weg, denn sie fallen mordend und brandschatzend in Ägypten ein. Radamis gebietet der barbarischen Horde mit Waffengewalt Einhalt und nimmt nebenbei auch Amonasro, Aidas Vater und König von Äthiopien, gefangen. Seine Identität bleibt vorerst verborgen und er beginnt alsbald seine finsteren Ränke zu schmieden. Sein Überleben verdankt er dabei Radamis, der beim ägyptischen König um Gnade für die Gefangenen bittet. Der entlässt alle, außer Amonasro, in die Freiheit. Doch die undankbaren Äthiopier rüsten sofort wieder auf und bedrängen Ägypten erneut. Am Ende ist es das Drama zweier Liebenden. Radamis, aus Liebe zum Verräter geworden, wird lebendig eingemauert. Aida, die das Schicksal des Geliebten kommen sah, hatte sich schon vorher in das tödliche Gefängnis geschlichen. Zuletzt feiern die beiden ihre Liebe ekstatisch im Tod. Hier sind Zweifel angebracht, in wie weit sich Verdi tatsächlich einem Realismus verschrieben hatte. Das letzte Duett ist eher Ausdruck von Wahnsinn, denn von Liebe.
Andreas Wiederman erzählte die Geschichte wie ein Relief aus Hieroglyphen und figürlichen Darstellungen, wie wir sie aus den Grabkammern und von den Stelen, den Geschichtsbüchern der alten Ägypter, kennen. Er ließ Darsteller und Chor, in historischen Kostümen gewandet, an den kahlen Betonwänden entlang auftreten, zumeist im Profil und somit weitestgehend zweidimensional, wie eine historische Illustration. Nur in seltenen Momenten wurde die Zweidimensionalität durchbrochen und Chor und Darsteller drangen in den Raum vor, beispielsweise, als den Äthiopiern die Freiheit wiedergegeben wurde. Freiheit ist halt raumgreifend.
Der ganze Raum wurde von zwei heutigen Archäologinnen bespielt, Christina Matschoss und Lisa Wittemer. Schließlich befanden wir uns in einem Museum, dem Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst. Dort wurden unterschiedlichste Artefakte und Exponate auch aus neuerer Zeit eingeliefert und aufbewahrt. Beispielweise der Spaten, mit dem Hans Neuenfels unter seinem Schreibtisch in Frankfurt seine „Aida“ ausgrub. Der Spiegel schrieb seinerzeit (1981) „In Frankfurt frevelte Hans Neuenfels ungleich kühner, aber ‚Aida‘ war auch überreif für Bilderstürmer wie Neuenfels und seinen fulminanten Bühnenbildner Erich Wonder. Nicht erst seit dem touristisch aufgezogenen Massenspektakel in der Arena zu Verona, nicht nur im Salzburger Festspielhaus, wo Karajans ‚Aida‘ aussieht, als sei sie von Albert Speer, wird die Dreiecksgeschichte vom ägyptischen Hofe zur Ausstattungs-Orgie aufgedonnnert. Für ‚Aida‘ hält sich fast jede Provinzbühne ihren kleinen Cecil B. de Mille.“ (Klaus Umbach) A. Wiedermann erklärte diese Inszenierung für den Beginn des Regietheaters.
Im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst ging es indes nicht um Bilderstürmerei, sondern um intelligente Aufklärung über Werk und Autor und über die Geschichte des Werkes. Da wurde Garibaldi (Thomas Thalmeier ) aufgefahren, um dem Freiheitsgedanken einen Körper zu geben. Aber auch Verdi selbst betrat die Szene, propagierte sein konservatives Credo, dass das Vergangene doch allemal fortschrittlicher war, und starb. Zur Geschichte an sich wurde Bertrand Russell befragt, der sie als „die Summe des Vermeidbaren“ charakterisierte. Nein, im Zentrum der Inszenierungen stand nicht die herzzerreißende Liebe zwischen Aida und Radamis, sondern das Werk an sich, das nach der Premiere nicht unbedingt mehr das ist, was es vorher war, als der Schleier der Verklärung noch auf ihm ruhte.
Dabei kamen die Darsteller keineswegs zu kurz. Unter den allemal wuchtigen Klängen, die das zwölfköpfige Orchester der Opera Incognita hervorbrachte und die durch den nackten Raum aus Stahlbeton verstärkt wurde, fand jeder Raum für seine individuelle Gestaltung. Anton Klotzners Radames war kraftvoller Krieger und verletzlicher Liebhaber zugleich. Die von Carolin Ritter gesungene und gespielte Amneris mutierte von der aufrichtig liebenden Königstochter zur rachsüchtigen Furie. Torsten Petsch, als verschlagener und skrupelloser Äthiopierkönig Amonasro, hatte die vielleicht vielschichtigste Rolle als König, Vater, Krieger und Intrigant, zumindest verglichen mit der Rolle des Oberpriesters Ramfis. Robson Bueno Tavares sakraler Habitus erinnerte an die heutigen Aufmärsche der Kardinäle am „Heiligen Stuhl“. Ebenso steif, nur präsidialer, agierte Herfinnur Arnjafjall als Il Re, göttlich, was die Pharaonen ja waren, und bestimmt. Stimmlich mit breitem Spektrum von markerschütternd bis zärtlich hauchend verlieh Kristin Ebner der Liebe und dem Leid der Aida klanglich überzeugend Ausdruck. Allein das physische Spiel des Schmerzes der Figur war ein wenig zu maßlos. Hier wäre weniger mehr gewesen.
Der zweidreiviertel Stunden dauernde Abend war, obgleich fast gänzlich ohne Bühnenbild, gänzlich ohne pomp & circumstance, ausgesprochen kurzweilig. Andreas Wiedermann hatte seine „Aida“ mit einer Vielzahl von ebenso intelligenten wie witzigen Glossen angereichert, ohne dabei der Geschichte Gewalt anzutun. Um einige Erkenntnisse und Anregungen reicher, oblag es dem Publikum, über das Werk zu urteilen. Das honorierte das Angebot mit ehrlicher Dankbarkeit, huldvollem Respekt und langanhaltendem Applaus.
Wolf Banitzki
Aida
Oper von Giuseppe Verdi
|
Solisten: Kristin Ebner, Carolin Ritter, Robson Bueno Tavares, Anton Klotzner, Torsten Petsch, Herfinnur Arnjafjall
Darsteller: Christina Matschoss, Lisa Wittemer, Thomas Thalmeier
Orchester: Violine I: Sören Bindemann, Violine II: Joseph Querleux, Viola: Christina Scap, Cello: Julia Klaushofer, Kontrabass: Sandra Cvitkovac, Flöte: Vera Klug, Oboe: Lorenz Eglhuber, Klarinette: Gabi Oder, Fagott: Tadija Mincic, Trompete: Tobias Lehmann/Philipp Lüdecke, Horn: Caroline Messner, Schlagwerk: Stephan Halbinger
Chor Opera Incognita: Hedi Bäcker, Sabine Becker, Veronika Berner, Cordula Gielen, Meike Schwarz, Hanna Schwenkglenks, Karin Seidel, Inka Klimkowski, Gudrun Kulessa, Melanie Mügschl, Lena Polke, Laura Popp, Ingrid Rottler, Juli van Scherpenberg, Nina Skalitzky, Verena Skalitzky, Patrizia Steinhauser, Susanne Steinhauser, Sabrina Wager, Martina Wendlinger, Katja Wülfert, Anette Zaboli, Theodor Bauer, Helmut Bayerer, Alexander Eckl, Bernhard Fernando, Thomas Greimel, Thomas Greinwald, Stephan Hintzen, Arnold Holler, Martin Holzner, Lukas Huge, Martin Kümmel, Martin Ha Minh, Martin Sellmayr, Rudolf Tobiasch,
Musikalische Leitung: Ernst Bartmann
Inszenierung: Andreas Wiedermann
|
Zentraltheater Immer nie am Meer von Bernd Steets
Käfighaltung
Es ist zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Und bei allem Witz könnte einem das Lachen auch schon vergehen. Denn wenn über ernste Situationen zu viel Komik verbreitet wird, so verschwimmen Lachen und Weinen zu einem undefinierbaren Gefühlsgemenge. Satire und Komik sind dann bisweilen auch Zeichen von Hilflosigkeit, der verfehlte therapeutische Ansatz Spannung aus einer Situation zu nehmen, wenn eigentlich angemessene Veränderung, Handlung gefordert wäre. Gesellschaftlich relevant?
Aus Rücksicht auf eine Frau, eine Nordic-Walkerin, die mitten auf der Straße läuft, verlässt der Fahrer die gesellschaftlich vereinbarte Fahrspur und verliert die Kontrolle über sein Auto. Gemeinsam mit seinen beiden Mitfahrern landet er im tiefen Wald, eingeklemmt zwischen Bäumen drehen die Reifen durch, glätten das Terrain. Ein Weiterkommen unmöglich, die Situation ausweglos. Das Fahrzeug, ein im Internet ersteigerter Gebrauchtwagen dessen ursprünglicher Besitzer Kurt Waldheim hieß und u.a. österreichischer Bundespräsident war, ist mit Sicherheitsglas gepanzert, somit vor der Außenwelt schützend und steckt fest. Treffender ist die allgemeine Weltlage kaum zu erkennen, benennen!
Ein Stahlkonstrukt, Lenkrad und drei Männer in Autositzen zogen die Aufmerksamkeit auf die Bühnenmitte. Es wurde dunkel im Raum und Schatten, Quietschen, Blubbern, Krachen war zu vernehmen, so dass es bei aller Tragik doch ein Lachen in die Gesichter der Zuschauer zauberte. Auf den Fernsehbildschirmen am Bühnenrand erschien, in schwarz weiß, das Bild von Bäumen. Die nächtliche Natur umfing die drei verunglückten Männer. Mühsam richteten sie sich auf, suchten Kontakt zueinander. Das eigentliche Drama nahm seinen Anfang. Regisseur Franz Josef Strohmeier stellte die Emotionen der Protagonisten ins Rampenlicht und damit auch den körperlichen Ausdruck. Mimik und Gestik trugen das Geschehen mindestens so deutlich wie der pointierte Text, denn ohne Worte war oft mehr gesagt. Christian Lex, Franz-Xaver Zeller, Norbert Ortner brillierten nachvollziehbar in ihren Rollen als richtig normale zeitgemäße Männer (das Schicksal spart keinen, aber gar keinen aus). Der Fahrer Baisch, Christian Lex versuchte sich im Verbreiten von Hoffnung: „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis man uns hier findet.“ Während sein Schwager Anzengruber, Norbert Ortner, resigniert die Zigarette zückte, die Mütze über den Kopf zog, um anschließend die Familie durch den Griff in die Pillendose erträglicher zu erfahren und sich von den Mustern der Vorväter zu verdrücken. Und dann auf dem Rücksitz der professionelle Unterhalter Schwanenmacher, der von seinem unvergessenen Jugendpartner träumte und zur Harmonika griff. Franz-Xaver Zeller verlor sich entrückt in der Poesie, die ihm Zeit und Raum füllte. Erleichtert lachend holte er Sekt aus dem Kofferraum hervor und verstaute danach das Durchgearbeitete darin. Das Groteske gipfelte im Versuch der Kontaktaufnahme zwischen der naivjungen Toni (Anna Tripp) im Wald und dem verzweifelt nach einer Lösung suchenden Doz. Dr. Baisch im Fahrzeug.
| |
 |
|
| |
Anna Tripp, Franz-Xaver Zeller,Christian Lex, Norbert Ortner,
© Manuel Nawrot
|
|
Eine scheinbar freie, gezielt trainierte Frau wandert auf den von den Männern gebauten Straßen, folgt diesen Wegen, nachdem es ihr gelang, den ihr zugewiesenen Platz in der Küche zu verlassen. Ob sie jemals das Meer erreichen wird, bleibt offen. Denn - „Wir sind hier.“ - „Immer nie am Meer.“ - heißt es im Stück und wir sitzen alle in geschlossenen ver-sicher-ten Autos. Wie facettenreich und, wie klein die Welt doch ist?
Die psycho-fokussierte Gesellschaft kennt offensichtlich nur ein Thema. Sigmund Freud hätte heute seine Freude an der Vielzahl von Fans und Followern. Einer Idee, wie seiner, mag durchaus Erkenntnis zu Grunde liegen, doch wenn wahre Gedanken ihre Verbreitung finden, so endet dies zumeist im tiefen Wörter Wald. Was dann geschieht, sagte am treffendsten Ödön von Horvath: „Ich denke ja gar nichts, ich sage es ja nur.“ Und schließlich bleibt nur der Humor, welcher über die finstere Seite kreisen und diese mit der hellen kollidieren lässt, wie in dieser unterhaltsamen „Psychogroteske“, verfasst von einigen erfahrenen Männer, Künstlern. Dass diese geschrieben und verfilmt im Jahr 2007, offenbart zudem den Status der festgefahrenen Lage! Die Inszenierung - das Nachstellen eines Autounfalls für Schaulustige - brachte es auf den Punkt und der Abend war ein erheiterndes kurzweilig sehenswertes Ereignis …..
C.M.Meier
Immer nie am Meer
Ein Theaterstück von Bernd Steets nach dem gleichnamigen Film von Antonin Svoboda
Drehbuch: Christoph Grissemann, Dirk Stermann, Heinz Strunk, Joerg Kalt, Antonin Svoboda
Christian Lex, Franz-Xaver Zeller, Norbert Ortner, Anna Tripp
Regie/Ausstattung: Franz Josef Strohmeier |