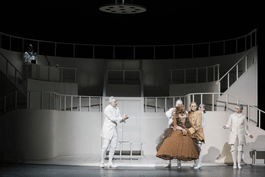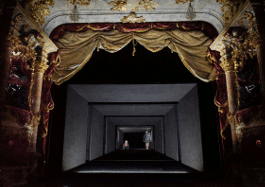Cuviliestheater Das Schlangenei von Ingmar Bergman
Gefahr im Verzug
Die Geschichte spielt im November des Jahres 1923, in jenem Jahr, in dem ein kleiner, noch unbedeutender Lokalpolitiker namens Adolf Hitler einen Putsch inszenierte. Der wird zwar im Keim erstickt, doch 10 Jahre später kommt der Mann, wie hinlänglich bekannt ist, mittels Ausnutzung der demokratischen Instrumentarien ganz legitim an die Macht. Ingmar Bergman siedelte seinen Film vor dem Hintergrund der historischen Ereignisse an. Er endet mit dem Scheitern des Putsches am 9. November 1923.
Abel Rosenberg war gemeinsam mit seinem Bruder Max und dessen früherer Ehefrau Manuela in Berlin gestrandet. Die Trapezartisten konnten wegen einer Handverletzung von Max nicht mehr auftreten und lebten nun in der Reichshauptstadt von ihrem Ersparten. Abel ergibt sich seiner Trunk- und Vergnügungssucht. Manuela arbeitet in einem Cabaret als Sängerin. Als Abel in der Woche vor dem 9. November angetrunken in das gemeinsame Zimmer einer Pension heimkehrt, findet er den Bruder tot im Bett sitzend vor. Max hat sich eine Kugel in den Kopf geschossen. Inspektor Bauer bearbeitet den Todesfall und er konfrontiert Abel mit weiteren mysteriösen Morden oder Selbstmorden, die in dieser Zeit vermehrt auftreten. Abel und Manuela können zur Aufklärung nichts beisteuern. Zu sehr sind sie mit ihrem täglichen Überlebenskampf beschäftigt.
Als die Dollars, die einzige stabile Währung, denn in Deutschland explodiert die Inflation, aufgebraucht sind, treffen sie einen alten Bekannten, der ihnen Hilfe anbietet. Hans Vergérus, die beiden waren ihm in Jugendtagen begegnet, war Abel wegen seiner bestialischen Neigungen in denkbar schlechter Erinnerung geblieben. Inzwischen ist Vergérus ein international anerkannter Mediziner, der in Berlin forscht. Er bietet Manuela seine Hilfe an und verschafft ihr eine Wohnung in dem Krankenhaus, in dem er arbeitet. Abel bekommt eine Beschäftigung im Krankenhausarchiv. Die Klinik entpuppt sich als ein kafkaeskes Labyrinth, aus dem es scheinbar kein Entrinnen mehr gibt. Als Abel nach durchzechter Nacht in die Krankenhauswohnung heimkehrt, findet er Manuela tot auf. Er verschafft sich gewaltsam Zutritt in die Forschungsräume und macht eine grauenvolle Entdeckung.
Regisseurin Anne Lenk hat eine Adaption des Films aus dem Jahr 1976/77 auf die Bühne des Cuvilliéstheaters gebracht. Dabei verzichtete sie auf nur ganz wenige Filmszenen, dafür aber gänzlich auf Bilder des Films. Das Bühnenbild von Judith Oswald zeigte eingangs einen schwarzen tunnelartigen Raum, der sich zum Bühnenhintergrund perspektivisch verengte. Das Bild stand gleichsam metaphorisch für eine düstere, nicht les- oder entschlüsselbare Zukunft. Am Ende wurden die Räume demontiert und gegeneinander verdreht, so, dass oben genanntes kafkaeskes Krankenhauslabyrinth entstand. Diese Räume wurden mit zirzensischen Attraktionen bevölkert, die allerdings den Charme und die Attraktivität eines theatralischen Leichenzuges hatten und die absurde Grundstimmung zusätzlich steigerte.
| |
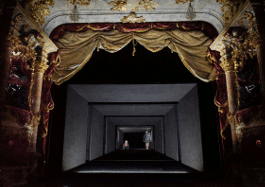 |
|
| |
Franz Pätzold, Nora Buzalka
© Thomas Aurin
|
|
Franz Pätzold spielt seinen Abel Rosenberg als einen unerschütterlicher Zyniker, unentwegt rauchend und saufend. Ihm oblag es auch, die Sprachkulissen zu schaffen und die Szenen einzufügen, die ungespielt blieben. Zum Beispiel die Szene, in der Abel einen Ziegelstein in das Schaufenster eines Wäschereigeschäftes schleuderte, dessen Inhaber ebenfalls Rosenberg hieß. Pätzold war, im Gegensatz zur Darstellung von David Carradine, nicht von seinen Ängsten überwältigt. Er zeigte wenig Regungen gegenüber der sich zersetzenden Ordnung, des aufkommenden Mobs und seinen grauenvollen Entdeckungen, die er in seinem letzten Gespräch mit Hans Vergérus machen musste. Thomas Lettow hingegen hatte einen ganz ähnlich Spielduktus, wie der im Film gestaltende Heinz Bennent. Kalt und gleichgültig der menschlichen Kreatur gegenüber, blieb er seiner Gesinnung und seiner Vision von einem vollkommenen Menschen treu. Gleiches galt für Oliver Nägele in der Rolle des Inspektors Bauer. Er brauchte einen Vergleich mit Gerd Fröbe nicht zu scheuen. Wesentlich zurückgenommener war die Figur der Manuela von der Regie angelegt. Nora Buzalke war es nicht vergönnt, die Figur so weit auszuformulieren, wie es Liv Ullmann tat.
Der direkte Vergleich sei an dieser Stelle nachgesehen, denn immerhin war die Vorlage der Film selbst und kein Roman oder eine Erzählung. Regisseurin Anne Lenk gelang eine sehr eigene und zeitgemäße Interpretation auf hohem künstlerischen Niveau. Allerdings hatten die ersten zwei Drittel der Inszenierung einige Längen, die wohl dem Fehlen der opulenten Bilderwelt Bergmans geschuldet waren. Der „Showdown“ riss indes wieder mit und entließ die Zuschauer nach knapp zwei Stunden mit einer starken rationalen und einer ebenso starken emotionalen Botschaft. Die rationale Botschaft provozierte der Inspektor Bauer mit den letzten Worten des Stücks, die lauteten: „Der Putsch von Herrn Hitler ist fehlgeschlagen. Das Ganze war ein einziges Fiasko. Herr Hitler und seine Horden haben die Stärke der deutschen Demokratie unterschätzt.“ Bald sollte sich herausstellen, wie jeder weiß oder zumindest wissen könnte, dass die deutsche Demokratie Herrn Hitler und sein Horden unterschätzt hatten. Die emotionale Botschaft resultierte aus den unübersehbaren Parallelen in der heutigen Gesellschaft. Und wer nicht wenigstens ein Unbehagen spürt, missversteht wieder einmal den Zustand der Gesellschaft.
Bergmans Film und auch die Inszenierung von Anne Lenk sind verstörend. Es liegt auf der Hand, dass die Inszenierung mehr ist, als nur eine Hommage auf den großen Filmemacher, der eine Zeit lang auch am Residenztheater gearbeitet hat und dessen 100. Geburtstag nächstes Jahr ins Haus steht. Gezeichnet vom eigenen Schicksal, er emigrierte aus Schweden wegen Bürokratiewillkür, war dieser Film sein erster politischer. Bis dahin hatte er sich als großer Psychologe ausgezeichnet, ein Ansatz, der im Film eine große Rolle spielt. Denn fehlender Altruismus oder gar Empathielosigkeit sind Auswüchse von Psychen denen es an Engagement fehlt, deren Egoismus das Maß der Dinge sind. Aber auch die Psyche ist in hohem Maß das Produkt ihrer Umwelt und wenn existenzielle Leere nicht mehr als Manko angesehen wird, weil man sie mit lächerlichen Ideologien, verschrobenen Religionen oder banalem Konsumismus auffüllt, ist Gefahr in Verzug.
Wolf Banitzki
Das Schlangenei
von Ingmar Bergman
Deutsch von Heiner Gimmler
|
Franz Pätzold, Nora Buzalka, Oliver Nägele, Thomas Lettow, Ulrike Willenbacher, Wolfram Rupperti
Regie: Anne Lenk |
Cuvilliéstheater Eines langen Tages Reise in die Nacht von Eugene O´Neill
Lautloser Untergang
„Ich finde mehr Glück in einer wirklichen Tragödie als in allen Stücken mit glücklichem Ausgang, die je geschrieben worden sind“, schrieb Eugene O´Neill, selbst ein großer Tragöde, dem die USA ihre endgültige dramatische Emanzipation in der Weltliteratur zu verdanken haben. Der Erfolg seiner Stücke lag wahrscheinlich auch in den autobiografischen Zügen begründet, denn Eugene O´Neills Leben stand seinen Dramen an Ereignis- und Konfliktreichtum in nichts nach.
„Eines langen Tages Reise in die Nacht“ spiegelt sein Leben wie kein anderes seiner Stücke. Es ist die Geschichte einer vierköpfigen amerikanischen Mittelstandsfamilie mit dem Oberhaupt Vater James Tyrone, Mutter Mary und den Söhnen James jr. und Edmund. Das Stück spielt an einem Augusttag, der vergleichsweise ereignislos verläuft, an dem sich dem Betrachter aber eine gewaltige Familientragödie offenbart. Vater James Tyrone ist, wie auch O’Neills irisch stämmiger Vater es war, ein Schauspieler, einstmals sehr begabt, der durch einen scheinbar genialen Schachzug sein Leben in eine Sackgasse manövrierte. Er erwarb für einen (scheinbaren) Spottpreis die Rechte am Stück „Der Graf von Monte Christo“ und tourte damit 16 Jahre lang durch ganz Europa. Jeder Versuch, aus dieser Rolle wieder herauszukommen, scheiterte kläglich. Immerhin, er verdiente mehr als 3000 $ in der Woche, was seinerzeit ein kleines Vermögen war. James O´Neill war besessen von krankhaftem Geiz und ebensolcher Panik vor Armut. Mutter Ella Quinlan O´Neill war ein fromme Katholikin, deren ohnehin strapaziöses Leben, denn sie begleitete ihren Mann während seiner Tourneen, aus den Fugen geriet, als der zweite Sohn Edmund als Kleinkind während ihrer Abwesenheit an Masern erkrankte und verstarb. Nach der Geburt von Eugene 1888 geriet sie in eine lebenslange Morphiumabhängigkeit.
Eugene selbst scheiterte auf einer Goldsuchermission in Honduras, fuhr auf einer Dreimastbark zur See, spielte kleine Rollen in den Aufführungen des Vaters und lernte dabei die schahle Seite des amerikanischen Unterhaltungstheaters kennen. Eine Lungenkrankheit bannte ihn 1912 einige Monate ans Krankenbett im Gaylord-Farm-Sanatorium. Es ist dasselbe Jahr, in dem auch das Stück angesiedelt ist, und zwar vor der Einlieferung ins Sanatorium. Dort las er „so ziemlich alle Klassiker“, einschließlich Nietzsche und Wedekind, und zwar in deutscher Sprache. Noch im Sanatorium schrieb Eugene 1913 sein erstes Drama „The Web“.
| |
 |
|
| |
Franz Pätzold, Oliver Nägele, Aurel Manthei
© Matthias Horn
|
|
Das Leben in der Familie O´Neill war ein unentwegter Kampf zwischen Anerkennungsbestreben, Schuldzuweisungen, Alkohol – und Morphiumsucht und schmerzlicher Trauer über Versagen und Scheitern. Und genau darum geht es auch in O´Neills Drama, das Thomas Dannemann auf die Bühne des Cuvilliéstheaters brachte. Johannes Schütz bereitete dafür eine große Spielfläche, die, an vier Seilen aufgehängt, ein schwankender Grund war, ständig in Bewegung, bar aller Sicherheit, allen festen Grundes. Das war prinzipiell eine durchaus akzeptable Übersetzung der Grundsituation des Stücks, wie sich im Verlauf des Abends herausstellte.
Dem Programmheft lag ein Zettel bei, der kommentarlos darauf verwies, dass die Rolle der Cathleen anstelle von Maya Haddad von Sinead Kennedy, der Souffleuse, übernommen werden würde. Offensichtlich hatte die Probenarbeit unter keinem guten Stern gestanden, denn unmittelbar vor Beginn des Spiels trat Aurel Manthei an die Rampe und tat kund und zu wissen, dass sich eine Schauspielerin verletzt habe und auf Krücken spielen würde. Gemeint war Sibylle Canonica, die die Mutter und Ehefrau Mary spielte. Vermutlich hätte niemand im Publikum Anstoß daran genommen, denn die Gehhilfen erschienen angesichts der Haltlosigkeit dieser Figur in ihrer täglichen Drogensucht und in ihrer nächtlichen peinvollen Schlaflosigkeit durchaus plausibel.
Das Spiel begann geradezu zärtlich, als Oliver Nägele in der Rolle des James Tyrone seiner Frau im Licht eines strahlenden Morgens Avancen machte. Und in der Tat klangen die Komplimente angesichts der (noch) strahlenden Sibylle Canonica aufrichtig und glaubhaft. Noch witzelte man über die Schwächen des anderen, doch als die Söhne dazu stießen, verfinsterte sich die Szene zusehends. Franz Pätzold als jüngerer Sohn Edmund Tyrone kämpfte mit einem Husten, den man nicht mehr als grippalen Infekt herunterspielen konnte und der sich am Ende als eine handfeste Tuberkulose erwies. Den älteren Sohn James Tyrone Junior gab Aurel Manthei, verzweifelt angriffslustig und voller Schwermut. Er war es immer wieder, der in seiner rüden und ungestümen Art die Wunden aufriss, die Auseinandersetzungen mit der Vergangenheit und dem momentanen Status voran trieb. So trat die Katastrophe der Familie Schicht um Schicht zu Tage und von dem idyllischen Bild des strahlenden Morgen blieb nichts mehr übrig.
Es ist ein großer Stoff, den Eugene O´Neill in eine kongeniale sprachliche Form gegossen hat. Der Realismus seiner Sprache setzt viele Facetten der Figuren und der Konflikte frei. Allein, an diesem Premierenabend konnte das Drama seine ganze Größe und seine Tragik nicht entfalten. Eine Katharsis gab es nicht; es blieb beim Anschauen. Thomas Dannemann war es nicht gelungen, die Konflikte so organisch ineinander zu verweben, dass eine durchgängige Spannung entstand. Die Wucht der Tragik konnten die Darsteller leider nicht entfesseln. Immer wieder kam es zu Spannungsabfällen, was z.T. auch dem Konzept der offenen Bühne geschuldet war, denn Dannemann hatte an der Rückwand der Bühne vier Spiegeltische aufstellen lassen, die gleichsam die Intimräume der einzelnen Personen darstellte. Dorthin zogen sie sich zurück, um ihren Part für sich weiter zu gestalten oder sich umzuziehen. Das lenkte nicht selten vom Geschehen auf der Schwebebühne ab. Zudem reichte der Spielraum bis in den letzten Winkel der Bühne, was die Wege sehr lang machte und der Akustik auch ebenfalls nicht zuträglich war.
Es ist ein intimes Stück, ein Orkan im Wasserglas, der an Tragik nichts offen lässt. Ein intimerer Rahmen wäre darum wohl angemessener gewesen, denn eine häusliche, vertrauliche Atmosphäre, und es wird oft genug von dem „fürchterlichen Haus“ gesprochen, kam nicht auf. Sollte Regisseur Thomas Dannemann im Auge gehabt haben, mit dieser Unverbindlichkeit, mit der Abstraktion vom Persönlichen eine gesellschaftspolitische Dimension zu transportieren, und das überaus interessante und unbedingt zur Lektüre empfohlene Programmheft legt diesen Gedanken nahe, hat er den effizienten Weg nicht gefunden. Dieser lautlose Untergang einer Familie ist durchaus exemplarisch und man kann dem Publikum durchaus vertrauen, dass es in der Lage ist, die gesellschaftliche Relevanz und Dimension zu erkennen.
Die Bestuhlung des Cuvilliéstheater ist jedenfalls nicht geeignet, zwei Stunden und zwanzig Minuten pausenlos durchzuhalten, wenn die Magie des Spiels den Zuschauer seinen Körper nicht vergessen macht.
Wolf Banitzki
Eines langen Tages Reise in die Nacht
von von Eugene O´Neill
Deutsch von Michael Walter
Sibylle Canonica, Aurel Manthei, Oliver Nägele, Franz Pätzold
Regie: Thomas Dannemann