Residenztheater Faust von Johann Wolfgang Goethe
Dramatischer Frankenstein
„Faust“ ist das deutsche Drama schlechthin, an dem nicht nur die literarisch-künstlerische Welt vorbei kommt, sondern auch die Philosophie. Die Rezeptionsgeschichte des Werkes ist eine wechselvolle, die ihre weltanschauliche Dimension erst durch das Eingreifen der marxistischen Geisteswissenschaften, insbesondere in der Person von Georg Lukács, entfaltete. Seine Interpretation zielte auf die letzten Fragen, die bis dato nur halbherzig angedeutet waren. Lukács nennt den „Faust“ „ein Drama der Menschengattung“, eine „Abbreviatur („Abkürzung“, „abgekürzte Schreibweise“- Anm. W.B.) der Menschheitsentwicklung selbst“. Die Konsequenzen dieser Sichtweisen sind gravierend, denn aus ihnen ergeben sich Fragestellungen wie: Gibt es „einen inneren Kern des Menschen“ der sich im Geschichtsprozess unverändert durchhält? Ist die Geschichte nur die Realisierung eines unveränderten „Gattungsmäßigen“? Wenn ja, dann ist der Mensch unrettbar einer Schadhaftigkeit unterworfen. Wozu also aufbegehren? Lassen wir unserem dunklen Trieb seinen Lauf! Die heutige Realität scheint zumindest nach diesem Muster gestrickt zu sein.
Goethe selbst, in „seinem dunklen Drang“, opponierte. Aufgewachsen im strengen Geist eines kirchlichen Lutheranismus, wurde ihm eingeschärft, dass die Wirklichkeit zwar von Gott geschaffen wurde, dass sie aber durch die Schuld der Menschen der Herrschaft des Satans anheimgefallen war. Einzige Möglichkeit, diesen Zustand zu überwinden, war ein entsagungsbereites Leben. Doch davon wollte der junge Goethe nichts wissen, denn er spürte in sich eine nicht zu unterdrückende „Anhänglichkeit an die Welt“. Insbesondere die Propagierung der „Erbsünde“ durch den Kirchenapparat stieß ihn ab. Seine Entwicklung glich dem Lauf eines fliehenden Feldhasen. Erlöst wurde er aus seiner Orientierungslosigkeit erst durch den Kontakt mit den Ideen Herders, der „das Irdische selbst mit den Attributen des Göttlichen“ belegte. Goethes Abkehr von der Religion und der Kirche war radikal. Er nahm die vom Kainsmal der Verderbtheit befreite Realität an, um sie mit allen Kräften seiner eigenen Person zu genießen.
Als er 1771 in Frankfurt in das Berufsleben eines Advokaten eintrat, tat er dies mit dem festen Vorsatz, die Gesellschaft zu bessern. Ein Revolutionär war er nicht, vielmehr ein rational denkender Reformer. Aber ungeduldig war er allemal: „Das Unverhältnis des engen und langsam bewegten bürgerlichen Kreises zu der Weite und Geschwindigkeit (s)eines Wesen“ machten ihm das Leben unerträglich, wie er in einem Brief an seine Mutter aus dem Jahr 1781 gestand. Er wollte dem „untätigen Leben zu Hause“ endlich entsagen, um eine „Weltrolle“ zu spielen, um ein „herrliches, handelndes Wesen“ zu sein. Er wollte, verkürzt gesagt, ein „faustischer“ Charakter sein, einer, der seinem inneren Drang konsequent folgt und somit „Großes“ bewegt. Dabei philosophierte er nicht in den freien Raum hinein, denn zwei philosophische Strömungen hatten inzwischen die Lufthoheit über den akademischen Mief der Scholastik erobert, der modifizierte Gottesbegriff von Baruch Spinoza (Deus siva natura – Gott ist in der Natur oder Gott ist die Natur – Pantheismus) und der radikale Atheismus des Materialisten, Aufklärers und Enzyklopädisten Paul Henri Thiry d'Holbach (1723-1789). Sein 1770 erschienenes Werk „System der Natur“ war gespickt mit radikalster Religionskritik. Das französische Parlament ordnete (naturgemäß) die Verbrennung seiner Werke an.
Goethe tat nur, was viele Frauen und Männer der Zeit taten, sie suchten nach einer neuen „sittlichen Kultur“. Den Materialismus verwarf er: „Allein wie hohl und leer ward uns in dieser tristen atheistischen Halbnacht zumute, in welcher die Erde mit allen ihren Gebilden, der Himmel mit allen seinen Gestirnen verschwand.“ Aber auch das Kirchenchristentum verwarf er und setzte seinen „Faust“ dagegen. Er war früh vertraut mit dem Volksbuch, mit dem Puppenspiel und dem Drama von Christopher Marlow. Aber auch persönliche Erfahrungen flossen ein, so die Liebe zu Frederike Brion, die er sitzen ließ, als er Straßburg verließ. Am 14. Januar 1772 wurde in Frankfurt eine gewisse Susanna Margarethe Brandt öffentlich mit dem Schwert enthauptet. Sie war des Kindsmordes für schuldig befunden worden. Beide Erfahrungen verschmolzen zur „Gretchen-Tragödie“.
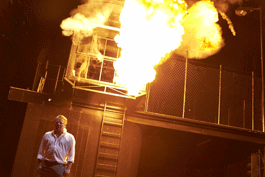 |
||
|
Werner Wölbern © Matthias Horn |
Nun wird sich der hoffentlich noch nicht gelangweilte Leser fragen, brauche ich dieses Wissen, um eine „Faust“-Inszenierung am Münchner Residenztheater genießen zu könne? Gewiss nicht, doch schaden kann es auch nicht. Immerhin kommt der Ruf des „Faust“, das deutsche Drama schlechthin zu sein, nicht von ungefähr. Es stellt alle wichtigen Fragen nach einer möglichen Befreiung des Menschen aus einer Existenz der vermeintlichen oder tatsächlichen Schicksalhaftigkeit. An der Größe dieser Fragestellung muss sich jede Inszenierung messen lassen. Auch die von Martin Kušej, die mit viel Getöse am 5. Juni über die Bühne des Residenztheaters donnerte.
Martin Kušej bot eine Lesart an, die am ehesten an die Malmöer Inszenierung von Ingmar Bergmann aus dem Jahr 1958 erinnert. Darin agierten Faust und Mephisto als Verbündete, als zwei Möglichkeiten, auf die Welt zu reagieren. Wer genau hinschaut, wird bemerken, dass die Inszenierung nur mit „Faust“ betitelt ist und nicht mit „der Tragödie erster Teil“. So bediente sich der Regisseur denn auch bei beiden Teilen, gerade wie es ins Konzept passt. Und das Konzept ließe sich vielleicht als „Roadmovie mit zwei Underdogs“ beschreiben, bei dem einer der Protagonisten eigentlich nicht recht weiß, was er will: Faust. Er weiß es auch am Ende des höllischen Spektakels nicht so recht. Die Handlung orientierte sich vornehmlich an Reizworten, die sich im „Faust“ durchaus finden, und die eine neue, moderne Bebilderung und somit auch Interpretation erfahren. Der Krieg ist ein Krieg von Terroristen (auch Kinder), die sich in die Luft sprengen oder massenhaft nieder metzeln. Die Ökonomie ist in der Hand von Mafiapaten. Liebe ist verwahrlost zu unumgänglicher Prostitution. Der Hexensabbat findet im Harry Klein oder im Berghain statt und die „guten Menschen“, hier bemühte Kušej seltsamer Weise das mythologische Paar Philemon und Baucis, werden weggebombt und verbrannt.
Kušej implantierte das ungleiche, gleiche Paar Faust und Mephisto in die Arbeitswelt, in einen pulsierenden, urbanen Alltag. Zumindest das Bühnenbild von Aleksandar Denić überzeugte und beeindruckte darüber hinaus. Sein düsterer, stählerner, dreistöckiger Aufbau mit Kran erinnerte irgendwie an den legendären „Red Hook“ von New York zu Zeiten von Eugene O'Neills. Al Capone startete in diesem Teil von Brooklyn seine Gangsterkarriere. In ständiger Drehbewegung entstanden immer wieder neue Räume, die aber allesamt einen Charakter atmeten: den der Unterschichten- und Gangsterexistenzen. Martin Kušej mag es hart, hart wie Metall. Bert Wrede lieferte ihm einen Klangteppich, der zwar nicht so exzessiv wie Heavy Metal war, der aber dieselbe Untergründigkeit mitbrachte. Das dumpfe Grollen war dazu angetan, zu verunsichern, denn die seismisch wahrnehmbaren Schwingungen waren höllisch, suggerierten ein Brodeln im Untergrund, verhießen Katastrophen.
Die Besetzung der Hauptrollen mit Werner Wölbern (Faust) und Bibiana Beglau (Mephisto) beschworen großes Theater. Das eben dies nicht stattfand, war keinesfalls den Darstellern anzulasten. Die taten ihr Möglichstes. Wölbern gab einen wuchtigen und dennoch sensiblen, von allen Hunden dieser Welt gehetzten Faust. Was allerdings zu keiner Zeit in der dreistündigen Vorstellung sichtbar wurde war, dass es sich bei Faust um einen Wissenschaftler, einen Gelehrten handelte. Kušej hatte den Eingangsmonolog, in dem Faust sein Dilemma umfänglich erklärte, trotz „eifrigem Bemühn“ keine verwertbaren Wahrheiten gefunden zu haben, schlichtweg gestrichen. Er ließ den Mann des Geistes stattdessen in die Welt der Gewalt eintauchen, um sich endlich einmal zu spüren. Und hier wurde es peinlich, denn diese Anleihe erinnerte an den Film „Fight Club“ von David Fincher. Darin verkörperte Edward Norten einen langweiligen Durchschnittsamerikaner, der, als er seine Wohnstatt mit Ikea-Möbel perfektioniert und konfektioniert hatte, den „Faust“ in sich erkannte und fortan blutbadend seine Fäuste sprechen ließ. Den Part des „Mephisto“ übernahm Brad Pitt, gleichsam prügelnd und dabei nicht einmal existent. Dass Bibiana Beglau die Rolle des Bösewichtes ohne Einschränkungen ausfüllen kann, stand bereits vor der Premiere fest. So waren die beiden Protagonisten auch darstellerisch eine Augenweide, eigenartig, differenziert und grenzgängerisch.
Doch sie spielten ein Spiel, dass sich vielleicht mit dem Kompositum „theatralischer Frankenstein“ umschreiben lässt. In Effekt haschender Weise waren Zitate miteinander geklittert worden, die weder dem Charakter noch dem Anliegen der Figur des Fausts dienlich waren. Als der Vorhang fiel, waren alle Fragen zu dieser Figur weitestgehend offen. Von den großen Fragestellungen im Goetheschen Werk ganz zu schweigen. Am Ende sah sich der Zuschauer einer apokalyptischen Welt gegenüber, in der es mehr ums Überleben ging, denn um eine willentliche (und vielleicht fortschrittliche) Gestaltung. Das wäre zumindest Goethes ureigenes Anliegen gewesen. Und Gretchen, deren Geschichte die Tragödie auf das menschliche Maß bringen sollte? Andrea Wenzl anfangs anrührend, aber kaum mehr als Projektionsfläche für Fausts erwachender Liebe (gleichsam ein Problem für den freien Geist), badete letztlich in ihrem Blut und verschied, ohne nennenswerte Erinnerungen zu hinterlassen. Hanna Scheibe als Frau Marthe hatte nicht viel mehr hinzuzufügen, als die Hausfrauenlibido einer Unbefriedigten, die sie hexentanzartig zur Schau stellen musste. Als Michele Cuciuffo in der Rolle des Valentin, Gretchens Bruder, nach dem Duell mit Faust seine Leben aushauchte und den Sterbemonolog im Goetheschen Original sprach, bekam man für einen kurzen Augenblick eine Ahnung von der Großartigkeit des Textes.
Fazit: Laut ging es zu und es wurde gewaltig bewegt. Allein, als Betrachter blieb man weitestgehend außen vor und unbewegt. Selbst als Kenner des Werkes hatte man in der ersten Hälfte einige Orientierungsprobleme, die wieder auftraten, als sich Kämpfer, Prostituierte, Terroristen, Paten und Tote morbide tummelten. Zugegeben, auf die Toten traf das nicht mehr zu. Vieles war plakativ und unverhältnismäßig suggestiv, einiges war auch verblüffend, z.B. als ein totes Pferd den Bühnenhimmel wie an einem Karussell hängend durchschwebte. Erschreckend waren die Donnerschläge und das Feuerwerk, bei denen man sich spontan an die vielen Theaterbrände erinnerte. Wirklich erhellend war wenig. Dass wir nicht in der besten aller Welten leben, ist hinlänglich bekannt und dass wir stets (vom Teufel) versucht werden auch. Faust als ein „herrliches, handelndes Wesen“ fiel aus. Schade.
Wolf Banitzki
Faust
von Johann Wolfgang Goethe
Werner Wölbern, Bibiana Beglau, Andrea Wenzl, Elisabeth Schwarz, Hanna Scheibe, Jörg Lichtenstein, Silja Bächli, Michele Cuciuffo, Simon Werdelis, Miguel Abrantes Ostrowski, Jürgen Stössinger, Götz Argus
Regie: Martin Kušej



