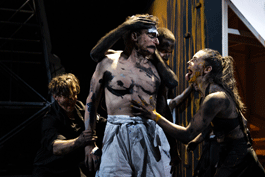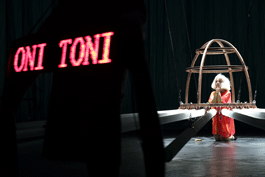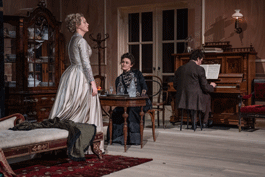Cuvilliés-Theater Die Bakchen - lasst uns tanzen von Peter Verhelst nach Euripides
Keine frohe Botschaft
Die Ordnung Thebens ist in Gefahr. Ein Mann namens Dionysos ist vor den Toren der Stadt erschienen. Er behauptet, ein Gott zu sein, nennt Zeus seinen Vater. Er besucht das zerstörte Haus und das Grab seiner Mutter Semele, die, nachdem sie des Antlitzes des Göttervaters für einen Augenaufschlag lang ansichtig geworden war, in Flammen aufging und verbrannte. Zeus rettete den Fötus, mit dem die Frau schwanger ging, und trug ihn in seinem Oberschenkel aus. Der junge Gott kam nicht nur nach Theben, um den Griechen die neue Religion zu bringen, sondern auch um Rache zu nehmen für die Mutter. Im Gefolge die Bakchen, eine ständig wachsende Schar Frauen, die in dionysischer Ekstase ihren neuen Gott feiern. Berauscht vom Wein, zerrissen sie dabei auch schon mal das ein oder andere Lebewesen, um es zu verinnerlichen, wie einst Zeus den noch ungeborenen Dionysos.
Die Altvorderen von Theben, der blinde Seher Teiresias und der Ex-König Kadmos, Gründervater der Stadt, sind ebenfalls vom Tanzvirus angesteckt und bereit und willens, sich in das Getümmel der Weiber in den Bergen zu stürzen. Doch Pentheus, der junge König sieht in dem Treiben eine existenzielle Bedrohung: „In schattigen Wäldern, feiern diesen neuen Gott / Dionysos, wer er immer ist, im Reigentanz. / Und volle Krüge stehen mitten in dem Kreis / Des Gelags; und eine duckt sich da, die andre dort / An geheime Plätze und gibt sich Männern hin zur Lust, / Sich stellend als im Gottesdienst Begeisterte – / Doch Liebeslust gilt ihnen mehr als Schwärmerei.“ Mitten im verderblichen Treiben der Bakchen an vorderster Front: Agaue, die Mutter von Pentheus.
Pentheus, der eine vernunft- und nicht rauschgesteuerte Welt präferiert, gibt Befehl, den vermeintlichen Gott festzusetzen. Der folgt dem Häscher erstaunlich willig und disputiert mit Pentheus über seine göttliche Herkunft und Berufung und versucht ihn von seiner Macht zu überzeugen. Am Ende gelingt es Dionysos, Pentheus in Frauenkleidern verborgen in die Berge und zu den Bakchen zu locken, wo er Opfer der eigenen, vom Rausch geblendeten Mutter wird. Im Angesicht der Bluttat rät Dionysos den entsetzten Thebanern mit Nachdruck, sich in das Unvermeidliche zu schicken und ihn als neuen Gott anzuerkennen: „So fügt euch endlich dem, was unabwendbar ist.“ Euripides wurde wegen des warnenden Stückes, auch er sah den Bestand der griechischen Demokratie und Herrschaft gefährdet, angefeindet und ging in das makedonische Exil, wo er 406 v.Chr. starb. 405/404 v.Chr. war Athens Herrschaft Geschichte, der Attische Seebund zerbrochen. Die Athener mussten sich den Spartanern unterwerfen. Auch sie hatte die warnenden Worte ihres Dramatikers geflissentlich überhört.
Regisseur und Choreograf Wim Vandekeybus brachte das antike Drama in einer leicht spezifizierten und gekürzten Fassung von Peter Verhelst auf die Bühne des Cuvilliés-Theaters. Dabei ging es ihm weniger um eine politische Botschaft, als vielmehr um die Monstrosität menschlichen Treibens unter den Vorzeichen von Religion, Machtanspruch und Rachegelüsten. Nüchtern betrachtet wird augenscheinlich, dass es sich hier nicht um eine untergegangene, mythische Welt handelt. Im Angesicht von internationalen Kriegen und zahllosen lokalen bewaffneten Konflikten, egal ob religiös begründet oder reinem Okkupationswillen folgend, wird schnell klar: es ist durchaus ein zeitgenössisches Thema. Potentaten und Tyrannen gebärden sich wie beleidigte Götter, einst homogene Völker sind in sich verstritten und massakrieren sich wegen ideologischer oder religiöser Spitzfindigkeiten und nahezu jeder sucht sein Heil in Nationalismus und Protektionismus.
| |
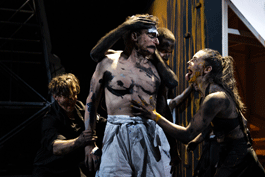 |
|
| |
René Dumont, Till Firit, Borna Babić, Zoe Gyssler
© Danny Willems
|
|
Wim Vandekeybus ist bekannt dafür, kein reines Sprechtheater zu inszenieren, sondern möglichst viele künstlerische Ausdrucksformen miteinander zu verquicken, um damit nicht zuletzt die Komplexität menschlichen Handelns auch in den nicht vordergründigen Facetten sichtbar zu machen. Für seine Münchner Inszenierung zog er die Kompagnie „Ultima Vez“ hinzu. Neben dem flämischen Schriftsteller Peter Verhelst, der, wie bereits erwähnt, den Text von Euripides für dieses Bühnenwerk adaptierte, verpflichtete er den Musiker und Komponisten Dijf Sanders, der den großen Stoff akustisch analysierte und kommentierte und zugleich die Rhythmik für den tänzerischen Part lieferte.
Heraus kam ein penibel durch choreografiertes Tragödientheater, das wuchtig den Raum füllte und eine Vielzahl von visuellen Reizen bot, dem zu folgen nicht immer leicht war. Und als ob der Reize noch nicht genug waren, schuf Vandekeybus zusätzlich noch eine bildnerische Seite. Er ließ den Maler Vincent Glowinski auf den großen weißen Flächen des abstrakten, aus zu- und gegeneinander komponierten grafischen Flächen bestehendes Bühnenbildes (Vincent Glowinski & Wim Vandekeybus) live malen. Dieser Vorgang war durchaus auch artistisch, denn Glowinskis weiße Fläche reichte bis hoch in den Bühnenboden und so stürzte er sich malend bisweilen auch kopfüber die Leinwand hinab.
Dominiert wurde der Theaterabend von den rauschhaften Elementen, tänzerisch beinahe durchgängig präsent und in Intervallen mehr oder weniger befeuert vom Sound der Musik. Immer wieder wurde sichtbar, dass einzelne Figuren die Kontrolle über sich verloren oder zum Spielball ekstatischer Abläufe wurden. Die Thebaner, die dem Treiben (noch) skeptisch gegenüberstanden, waren anfangs weiß gekleidet, die Bakchen agierten in Schwarz. (Kostüme Isabelle Lhoas) Die Offenbarungen des Gottes Dionysos muten anarchisch an, vor allem aber sprengten sie stets die Grenzen, zerstampften das Althergebrachte und verhöhnten vermeintlich eherne Regeln. Selbst der Tod oder die Tötung hatte einen festen Platz im Ritus. Feines psychologisches Theater fand eher weniger statt, dazu waren die Bilder zu groß, zu wuchtig und zu schreiend. Die Tänzer übernahmen den Part, den seelischen Zuständen körperlichen Ausdruck zu verleihen.
Es fand dennoch auch Sprechtheater statt. So hatte Wolfram Rupperti in der Rolle des Kadmos die Möglichkeit, das Bild eines guten Herrschers zu entwerfen. Dabei wurde offenbar, dass seine Auffassungen sich deutlich von denen des Pentheus unterschieden. Für Till Firit war diese Rolle die eines dem Untergang geweihten Monarchen und somit eine schmerzvolle und verzweifelte. Der blinde Seher Teiresias, gespielt von René Dumont, brach einen Stab für den neuen Gott, den Pentheus „fremder Gaukler, Zauberer und Betrüger“ nannte. In Demeter, der Göttin, die dem Menschen Nahrung schenkt, und in Dionysos, den Erfinder des Rebensaftes, der „Tröstung mühbeladner Sterblicher im Grame“, aber auch „Schlummer“ spendet und des „Tages Hitze und Last“ vergessen macht, sah Teiresias die Dualität des Lebens, die freien Willens und offenen Herzens angenommen werden sollte. Doch es gab kein Happy End und als Agaue, gestaltet von Sylvana Krappatsch, erkennen musste, dass sie den eignen Sohn getötet und damit das Geschlecht Kadmos ausgelöscht hatte, blieb ihr nur noch das kummervolle Exil und das Vergessen.
Wim Vandekeybus ließ beinahe sämtlicher Darsteller in die unterschiedlichsten Rollen, vor allem die des Dionysos schlüpfen, was zur Folge hatte, dass die Orientierung gelegentlich beeinträchtigt war. Doch da die im Euripidesschen Drama enthaltenen Intrigen, Kabalen und dramaturgischen Konstellationen ohnehin auf das Wesentlichste reduziert waren, blieb die Geschichte übersichtlich. Zuletzt triumphiert ohnehin nur einer, Dionysos, der, ausgestattet mit der Kraft des Vaters Zeus, tat, was getan werden musste: „Das sprech ich nicht als eines irdischen Vaters, nein, / Als Sohn des Zeus! und hättet ihr, als euch es nicht / Gefiel, zur Demut euch entschlossen, euer Hort / Verblieb der Zeussohn, und ihr konntet glücklich sein!“ Eine „frohe Botschaft“ war es nicht, auch nicht auf den Bildern von Vincent Glowinski. Hier triumphierte zuletzt das Animalische, das Stierköpfige, das Bocksbeinige und mitten im letzten Bild prangte ein gewaltiger Penis wie ein überlegener Sieger, an dem niemand vorbei kommt.
Es war ein aufregender, bild- und tongewaltiger Theaterabend, der vom Premierenpublikum zu Recht frenetisch gefeiert wurde. Eine einfache Botschaft gab es nicht, vielmehr ein Hinweis darauf, dass es keine simplen Botschaften gibt. Zu vielfältig sind die Kräfte, die wirken, zu wirkmächtig sind die Argumente derer, denen die (physische) Übermacht gegeben ist und zu schlicht ist der Geist der Menschheit, alles, das Gute wie das Böse, immer durchschauen zu können. Und doch sollte nicht akzeptiert werden, dass es eine einzige Allmacht gibt, die uns in einer Schicksalhaftigkeit gefangen hält. Soweit zumindest sollten wir über den Mythos hinaus gelangt sein.
Wolf Banitzki
Die Bakchen - lasst uns tanzen
von Peter Verhelst nach Euripides
Borna Babić, René Dumont, Till Firit, Vincent Glowinski, Zoe Gyssler, Sylvana Krappatsch, Horacio Macuacua, Aymará Parola, Wolfram Rupperti, Dijf Sanders, Niklas Wetzel
Regie & Choreographie: Wim Vandekeybus
|
Cuvilliéstheater Die Verlobung in St. Domingo von Heinrich von Kleist
Ästhetisch ambitioniert und wenig schlüssig
Im Jahr 1803 brach auf Haiti, der französischen Kolonie, auch „Perle der Antillen“ genannt, der einzige siegreiche Sklavenaufstand der bisherigen Geschichte unter der Führung des Generals Dessalines aus, unter dessen Befehl sich 30.000 Sklaven und freie Schwarze versammelt hatten. Die Zeitzeugen und Gazetten sprachen von ungeheuerlichen Massakern unter der weißen Bevölkerung. Tatsächlich aber zogen die Truppen der Aufständischen beinahe ausschließlich Franzosen, also Vertreter der Kolonialmacht zur Verantwortung. Ausgelöst wurden die Unruhen auf Haiti bereits 13 Jahre zuvor durch die Weigerung der weißen Plantagenbesitzer, den Beschluss der französischen Nationalversammlung von 1790, in dem der französische Teil der Insel die Autonomie zugestanden wurde, anzuerkennen. Daraufhin erhoben sich die mit brutalen Mitteln unterdrückten Neger – alle Sklaven wurden gemeinhin als Neger bezeichnet – unter dem Befehl Toussaint I`Ouverture und erlangte im Jahr 1798 durch die Erklärung des Direktoriums die völlige Freiheit und die gleichen bürgerlichen Rechte. 1801 erfolgte die Proklamation der Souveränität Haitis.
Napoleon Bonaparte, dem auch weiterhin an der Ausbeutung der Insel gelegen war, sandte ein Heer unter Führung seines Schwagers Leclerc auf die Insel, dem es gelang Toussaint vernichtend zu schlagen und als Gefangenen nach Frankreich zu überführen, wo er bald darauf im Fort de Joux starb. Auf den Versuch, die Sklaverei erneut einzuführen, kam es zu dem oben genannten Aufstand unter Toussaints ehemaligem Adjutanten Jean Jacques Dessalines, der die Franzosen von der Insel fegte und sich 1804 als Jakob I. zum Kaiser krönen ließ. Der Mann verkam selbst zum unbarmherzigen Despoten und fiel 1806 einer Verschwörung zum Opfer. Soviel zum historischen Hintergrund der Kleistschen Erzählung.
Deren Inhalt beginnt mit der Flucht des Schweitzers Gustav von der Ried vor den mordenden und brandschatzenden Truppen der Schwarzen. Ziel ist St. Domingo, von wo aus der Schweizer und seine Familie nach Europa heimzukehren hoffen. Doch Ried gerät in das Haus des besonders blutrünstigen Negers Congo Hoango und dessen Frau, der Mulattin Babekan. Die Bewohner des Hauses haben sämtliche Weiße, die sich hilfesuchend an sie gewandt haben, in die Wohnstatt gelockt und ermordet. Auch Gustav von der Ried soll dieses Schicksal beschieden sein, allein, der Hausherr Hoango ist für einige Tage in militärischen Unternehmungen außer Haus. Gustav, dessen zwölfköpfiger Familienanhang sich in einem unweit entfernten Wald versteckt hält, wird von der Hausherrin und deren Tochter, der Mestizin Toni umgarnt. Ein wichtiges Argument für das Vertrauen in die Gastgeber ist die Hautfarbe Tonis, deren leiblicher Vater ein reicher französischer Kaufmann ist: „Euch kann ich mich anvertrauen; aus der Farbe Eures Gesichts schimmert mir ein Strahl von der meinigen entgegen.“
Toni und Gustav verlieben sich ineinander, denn Gustav erkennt in dem fünfzehnjährigen Mädchen die Züge seiner einstigen Verlobten wieder, die für ihn auf dem Schafott gestorben ist. Gustav im Augenblick des Erkennens: „(…) ein Zug von ausnehmender Anmut spielte um ihre Lippen und über ihre langen, über die gesenkten Augen hervorragenden Augenwimpern; er hätte, bis auf die Farbe, die ihm anstößig war, schwören mögen, dass er nie etwas Schöneres gesehen.“ Immerhin, man bemerke: „… bis auf die Farbe, die ihm anstößig war…“ Es folgt eine nicht unerhebliche Anzahl von Wendungen und Ränkespielen, an deren Ende ein Missverständnis Gustav dazu bringt, die Waffe gegen Toni zu erheben und sie zu erschießen. Als er erkennen muss, dass er ihrer Liebe sicher sein konnte und alles nur zu seinem Besten geschehen war, richtet er die Waffe gegen sich selbst.
| |
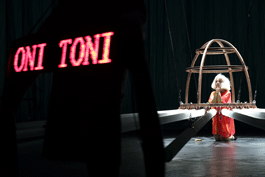 |
|
| |
Mathilde Bundschuh
© Andreas Pohlmann
|
|
Regisseur und Musiker Robert Borgmann brachte die Geschichte als eine ästhetisch hochstilisierte Performance auf die Bühne, begleitet von sphärischer Musik und einer ausgefeilten Lichtregie. (Licht: Georgij Belaga) Robert Borgmann agierte selbst life als Musiker auf der Bühne, gewandet in einem Konterfei des Jazzmusikers John Coltrane. Über der Mitte hing ein gewaltiger Kronleuchter, der sich wie ein gigantischer Strahlenkranz spreizen und verengen ließ und herabgesenkt sogar Darsteller umhüllen konnte. Es wurde bereits vor der Vorstellung davor gewarnt, dass stroboskopisches Licht zur Anwendung kommen würde, was für sensible Augen durchaus schmerzhaft sein kann. Die Bühne war von einem umgehenden Vorhang begrenzt, der zuletzt von den Darstellern niedergerissen wurde und den nackten Bühnenraum sichtbar werden ließ. (Bühne Rocco Peuker) Der Sound Borgmanns hob die Geschehnisse auf der Bühne auf eine andere Wahrnehmungsebene; es blieb allerdings nicht aus, dass die Klänge für manche Ohren auch belastend wurden.
Borgmann erzählte die Geschichte nicht gradlinig, sondern verlieh ihr einen Rahmen. Mathilde Bundschuh und Marcel Heuperman traten nicht wie erwartet als Toni und Gustav auf, sondern gaben sich als Henriette und Heinrich zu erkennen. Gemeint waren Henriette Vogel und Heinrich von Kleist, die sich gemeinsam am 21. November 1811 am Kleinen Wannsee bei Berlin das Leben nahmen. Borgmann sieht diese Tat in der im März bis April erstmals in der Berliner Zeitung der „Freimütige“ abgedruckten Erzählung vorweg genommen. Das ist eine recht gewagte These, zumal Kleist vermutlich bereits 1807 mit dem Thema ernsthaft in Berührung kam. Da weilte er nämlich als vermeintlicher Spion, am Berliner Stadttor aufgegriffen und nach Frankreich deportiert, kurzzeitig im Fort de Joux.
Mit Bildnissen auf den Kostümen legt der Regisseur immer wieder Interpretationsfährten. Bei dem Thema Flüchtlinge und Ausweisungen musste Horst Seehofer als Ballon herhalten. Aber auch Franz Fanon oder Jean Paul Sartre, der für Fanons Schlüsselwerk gegen den Kolonialismus das Vorwort geschrieben hatte, wurde bildhaft zitiert. Ebenso Opfer rassistischer Ausschreitungen in den USA und Anführer der haitianischen Revolution. Es waren ein Vielzahl von visuellen Zitaten, die sich allerdings kaum oder nur selten aus dem Spiel erschlossen. Dazu musste das Programmheft zu Rate gezogen werden. Plakativ wurde immer wieder der Satz zitiert und auch auf den Vorhang projiziert: „Der Tod ist die Maske der Revolution; die Revolution ist die Maske des Todes.“ Das schwängerte die Vorgänge, die nicht immer leicht nachzuvollziehen waren, mit Bedeutung, allein die Wirkung blieb weitestgehend aus. Tatsächlich war der Abend kein homogenes Ereignis, das in den Bann schlug oder durch den Fortgang der Geschichte fesselte.
Mathilde Bundschuh und Marcel Heuperman agierten physisch und stimmlich sehr aufwendig und engagiert. Doch zu viel verwirrte, erschien überflüssig und verhinderte die Kontinuität der Reise durch die Geschichte. Schwer bis unverständlich war bereits die Eingangsszene, in der die Sängerin Marie-Christiane Nishimwe, nachdem der Kronleuchter sie freigegeben hatte, von drei seltsamen, wie überdimensionierte eingefrorene Kaugummiblasen wirkende Figuren heimgesucht wurden, die ihr ganz augenscheinlich Gewalt antaten. Immerhin überzeugten die Auftritte der Kinder Vito Brown und Samuel Wilson O´Bryant (Alternierend: Cyril Philipp und Mimo Saine) als Nanky und Seppy, den unehelich gezeugten Kindern von Hoango. Ihre Pantomimen, die Protagonisten illustrierend, waren ein durchaus gelungener inszenatorischer Einfall.
Auch der Auftritt Thomas Schmausers als Michael war absolut sehenswert. Dabei muss angemerkt werden, dass beinahe jeder Auftritt von Thomas Schmauser sehenswert ist, denn er ist ein wahrer Magier und könnte wohl auch den Inhalt eines Telefonbuches zum Leben erwecken. Mit Michael war Michael Jackson gemeint. Als selbiger erstand Schmauser von der Bahre des Leichenschauhauses auf und erzählte, die bekannten Moves Michael Jacksons, wie den Moonwalk, tanzend, die Geschichte in ihren wesentlichen Zügen noch einmal. Immerhin, das Zitat machte Sinn, denn Micheal Jackson stand wie kaum ein anderer für das existenzielle Unbehagen, die vermeintlich falsche Hautfarbe zu haben. Unterm Strich muss jedoch eingestanden werden, dass der Inszenierung die Schlüssigkeit fehlte, die sie zu einem spannenden Theaterabend gemacht hätte. Die Ästhetik hat das Premierenpublikum sichtlich gespalten, denn vieles wird die unterschiedlichen „Geschmäcker“ sehr unterschiedlich angesprochen haben. Geschmack sollte zwar kein wichtiges Kriterium in einer Theaterkritik sein, doch an der Tatsache, dass es ihn in unterschiedlichster Ausbildung gibt, kommt man wohl nicht vorbei, wenn man das Publikum nicht ignorieren will.
Wolf Banitzki
Die Verlobung in St. Domingo
von Heinrich von Kleist
Mathilde Bundschuh, Marcel Heuperman, Marie-Christiane Nishimwe, Thomas Schmauser, Vito Brown, Samuel Wilson O´Bryant, Cyril Philipp, Mimo Saine, Robert Borgmann
Regie/Musik: Robert Borgmann
|