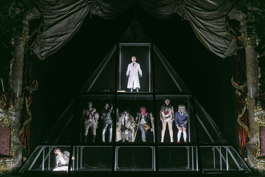Cuvilliéstheater Nora oder Ein Puppenheim von Henrik Ibsen
Ibsen zwischen Tür und Angel
Ein Drama kehrt zurück: „Nora oder Ein Puppenheim“. Jetzt im Cuvilliéstheater zu sehen, erlebte das Stück am 3. März 1888 deine deutsche Erstaufführung im Münchner Residenztheater. Das Drama erzählt von einer Trennung. Nora verlässt ihren Mann Torvald Helmer und ihre Kinder in der Hoffnung, die Trennung möge beide so stark verändern, „dass ein Zusammenleben zwischen uns beiden eine Ehe werden könnte“. Grund dafür ist, dass Nora, die sich wie eine Puppenfrau in einem Puppenheim fühlt, begonnen hat, aus Liebe zu lügen, denn sie muss vor ihrem Mann ein Geheimnis hüten, das sie stolz mit der Welt, vorerst mit Christine Linde, teilt. Einige Jahre zuvor stand das Leben ihres todkranken Mannes Torvald Helmer auf dem Spiel. Nora lieh sich von dem unredlichen Rechtsanwalt Krogstad eine größere Summe Geld, für das sie die Unterschrift ihres Vaters fälschte. Nun schickt sich Torvald Helmer an, die Bank als Direktor zu übernehmen, Krogstad, der ihm unsympathisch ist und der zudem ebenfalls Unterschriften gefälscht hatte, zu entlassen und statt seiner Noras mittellose Freundin Christine Linde einzustellen. Torvald Helmer ist ein Mann mit unerschütterlichen Vorsätzen und duldet keine Regelwidrigkeiten. Krogstad, durch seinen Fehltritt dauerhaft stigmatisiert und in aussichtsloser Lage, nutzt das gemeinsame Geheimnis, um Nora zu erpressen. Schließlich informiert Krogstad Torvald Helmer. Der ist schockiert: „O, welch ein entsetzliches Erwachen! Diese ganzen acht Jahre hindurch – sie, die meine Freude und mein Stolz war – eine Heuchlerin, eine Lügnerin – ja noch Schlimmeres, Schlimmeres – eine Verbrecherin!“ Nora, zutiefst überzeugt davon, das Richtige für ihren Mann und ihren Vater getan zu haben, ist ihrerseits darüber entsetzt, dass Torvald bereit ist, die Geschichte des Skandals wegen unter den Teppich zu kehren. Aufrichtigkeit ist ihr wichtiger als die bürgerliche Scheinmoral: „Ich muss herauskriegen, wer recht hat, die Gesellschaft oder ich.“
Es ist ein Psychogramm der bürgerlichen Gesellschaft, das heute durchaus noch Gültigkeit hat in einer Welt, in der der Schein bare Münze ist. „Alle diese Menschen leben ein schattenhaftes Leben; sie erleben fast keine Taten und Dinge, fast ausschließlich Gedanken, Stimmungen und Verstimmungen. Sie wollen wenig, sie tun fast nichts. Sie denken übers Denken, fühlen sich fühlen und treiben Autopsychologie.“ Mit diesen Worten umriss Hugo von Hofmannsthal Ibsens Dramatik. Bei aller Ambitioniertheit, und Alfred Polgar unterstellt dem Dramatiker sogar: „Ibsen hält gern der Moral Moralpredigten und ruft die Ordnung zur Ordnung“, war Ibsen in allererster Instanz sensibler und aufrichtiger Dichter und erst in zweiter Sozialphilosoph. Den Kritiker Georg Brandes ließ er wissen: „Es gilt, sich selbst zu retten.“ Mit Nora, dem ursprünglich verspielten Püppchen in ihrem Puppenheim und der zuletzt desillusionierten, aber selbstbestimmen Frau im Angesicht eines familiären Scherbenhaufens, rettete sich wohl auch ihr Schöpfer.
Das Ibsensche Drama nahm in den letzten Jahrzehnten immer dann eine Schlüsselstellung ein, wenn es um Fragen der Emanzipation von Frauen und Rollenverhalten ging. Nora war ein exemplarisches Wesen in einer Versorgungsgesellschaft, unfrei in der Selbstentfaltung, frei von Besitz, in der ehelichen Gemeinschaft weitestgehend ohne Mitbestimmung. Ihr erster und wichtigster Wert war ihr Körper. Alte Hüte, möchte man meinen, und auch Regisseurin Mateja Koležnik kündigte vorab an, ihre Lesart nicht an den emanzipatorischen Potenzen der Weiblichkeit in der Familie auszurichten. Sie möchte es universeller auf die Bühne gebracht sehen. Im Vordergrund steht für Koležnik „ihr Freiheitsdrang, ihre Lebenslust und ihr Unbehagen an der Kultur von Regeln und Geboten“. (Werbetext Residenztheater) Das klingt gut und dennoch entsteht ein Unbehagen angesichts der Realitäten, die geprägt sind von Völkerwanderungen, religiöser Verblödung und sozialen und ökonomischen Unsicherheiten. Die haben dazu geführt, dass sich, wie statistische Erhebungen verzeichnen konnten, die Ehe als Versorgungseinrichtung in den jüngeren Generationen wieder zunehmender Beliebtheit erfreut. Recep Tayyip Erdoğan erklärte unlängst, er sehe in jeder Frau in erster Linie die Mutter. Seine Gattin Emine preist indes die Vorzüge eines Harems. Und mit der syrischen Flüchtlingskrise hat die Türkei endlich ein probates Mittel an der Hand, die Aufnahme in die europäische Gemeinschaft zu erpressen. Wird das die europäischen Werte verändern? Und ob! Die gute alte Moral von Ibsen hat also längst noch nicht ausgedient.
 |
||
|
Genija Rykova © Thomas Aurin |
Mateja Koležnik hatte, und das muss ihr zugutegehalten werden, gerade einmal zweieihalb Wochen Zeit für ihre Einrichtung. Eine reine Neuinszenierung war es nicht, denn es handelte sich um eine Übernahme vom Stadttheater Klagenfurt. Großartig besetzt, konnte der Zuschauer im Cuvilliéstheater einen sehr soliden Abend erleben, der handwerklich überzeugte. Die vorab definierte Lesart, war nur bedingt herauszuhören. Die Figuren waren dicht am Text und transportierten voller innerer Logik, was von ihnen erwartet wurde. Ein Nachteil war das nicht, denn Ibsens Geschichte überzeugt seit beinahe 140 Jahren. Das Aufregendste des Abends war vielleicht das Bühnenbild von Raimund Orfeo Voigt. Das Fragment eines Zimmers wuchs auf einem Podest zur doppelten Erhöhung, denn Bühne ist an sich ja schon eine Erhöhung. Diese besondere Heraushebung der Geschichte scheint ein wichtiges Kunstmittel der Regisseurin zu sein, da sie dieses Mittel bereits in ihrer Inszenierung von „Madame Bovary“ in der vergangenen Spielzeit zur Anwendung brachte. Dieses Bühnenbild war allerdings noch radikaler, denn zwei große gegenüberliegende Türen, die zudem in den Raum hinein aufgingen und häufig nur einen Spielspalt ließen, machten den Raum zu einem Durchgangszimmer, zu einem Flur. Und so wurden weite Teile des Stückes zwischen Tür und Angel gespielt. Das machte insofern Sinn, da der Konflikt die Saturiertheit und die Glückseligkeit des bürgerlichen Wohnzimmers oder Salons bedrohte. Akustisch wurde dieser Zustand gleichsam hörbar, denn hinter einer grollenden Klangfassade tickerten feine Töne in den Raum, wie man sie von Geiger-Müller-Zählern kennt, mit denen man Radioaktivität misst. Und genau so war auch die Atmosphäre, radioaktiv aufgeladen. (Bühnenmusik Mitja Vrhovnik-Smrekar)
Getragen wurde die Inszenierung von einer zwitschernden und springlebendigen Genija Rykova. Ihre zauberhafte Nora verkörperte alles, was Till Firit in der Rolle des Torvald Helmer vollmundig pries. So war Nora das Püppchen, die Lerche, der schönste Wert, über den er, der Bankdirektor, verfügt. Firits Empathielosigkeit wurde wortgewand und durch sehr beamtenhaft-strammen Spielgestus kaschiert. Nicht minder überzeugend agierte Markus Hering als dezenzent-nekrophiler Doktor Rank. Herrlich peinlich die Szene, als er Nora seine Liebe gestand. Nicht weniger originell war sein allerletzter Auf- und Abgang als Nosferatu, inklusive Schattenspiel. Gunther Eckes Krogstad hatte etwas anrührend Solides für einen windigen Anwalt. Dass Kristine Linde, blaustrümpfig-trocken von Hanna Scheibe gegeben, diesen Verzweifelten bekehren konnte, war dem brodelnden Vulkan ihrer lebenslangen Liebe für den Mann geschuldet, auf den sie aus ökonomischen Gründen in der Jugend verzichten musste.
Die Theatergeschichte ging auch mit dem großen Ibsen hart ins Gericht. „Alle diese Stücke sind Monologe Ibsens mit verteilten Ideen. Nicht Stücke, in denen Menschen Ideen haben oder von Ideen besessen sind. So und so vom Verfasser benannte Bühnenarbeiter tragen nach einem vorgezeichneten Schema Aufschriften herum, und Ibsen redet dazu mit einer ins Natürliche verstellten Stimme das Problematische über den modernen Menschen.“ Diesem Urteil Franz Bleis kann man sich als Leser seiner Stücke durchaus anschließen. Für den Zuschauer im Cuvilliéstheater jedoch gelang es Mateja Koležnik und den durchweg hervorragenden Schauspielern, dieses Manko Ibsenscher Dramatik vergessen zu machen. Es war eine grundsolide Arbeit, die dem Premierenpublikum etliche Bravos wert war.
Wolf Banitzki
Nora oder Ein Puppenheim
von Henrik Ibsen
| Genija Rykova, Till Firit, Hanna Scheibe, Gunther Eckes, Markus Hering Regie: Mateja Koležnik |