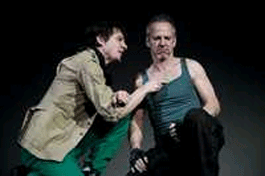Marstall Der Mann der die Welt aß von Nis-Momme Stockmann
Viel Lärm ... Worum?
“Ich bin frei!“, schreit der Sohn in die Welt hinaus und die Welt denkt: „Schön für ihn, aber wovon ist er frei?“ Zuerst einmal ist er frei von Arbeit, denn obgleich er ein für die Firma unverzichtbarer Mitarbeiter war, hat man ihn gefeuert. Warum? Unbotmäßigkeiten, aber genaueres weiß man nicht. Und dann ist er frei von Frau und Kindern, die sich aus dem Staub gemacht haben und jetzt mit Ulf leben, dem Freund und ehemaligem Arbeitskollegen. Auch ist er frei von Geld, dem gültigen Zahlungsmittel, ohne das er eigentlich gar nicht existent ist. Eine persona non grata, so ganz ohne Konto und Guthaben, aber doch immerhin frei. Oder? Nun, da ist der Vater, eigentlich ein recht umgänglicher und auf den ersten Blick liebenswerter Mensch, wenn er sich in seiner fortschreitenden Demenz nicht die Hände verbrennen, die Zunge abbeißen und sich nackt vor seinem Sohn im Schrank verstecken würde. In lichten Momenten ist der Vater bereit, Abbitte zu leisten, denn er liebt seinen Sohn und glaubt fest an ihn, besonders jetzt, wo der sich selbstständig gemacht hat. Doch die Selbständigkeit ist ein Chimäre, denn er hat weder Geld, noch eine Möglichkeit, an solches heranzukommen, denn niemand will mehr für ihn, den Freien, den Aussteiger bürgen. Die Freiheit des Sohnes erscheint allen als ein großes Chaos.
Über diesen Eindruck gelangten allerdings auch einige Zuschauer im Marstall nicht wirklich hinaus, denn eigentlich wurde ihnen vorenthalten, warum der Drang nach Freiheit so groß war. Freiheit ist ein grandiose Sache, und hat man sie erst einmal, fängt man was mit ihr an. In Stockmanns Drama entsprach der Begriff Freiheit jedoch eher dem Entbundensein von Verantwortung. Mit keiner Silbe erfuhr der Zuschauer etwas von den Träumen des Protagonisten, obgleich er oft genug von seiner Unternehmung spricht, in die er verbal aufbricht und in die er nicht aufbrechen kann, weil niemand bereit ist, Geld dafür zu geben. Aber wenn man erst einmal so frei ist wie der Sohn, dann „scheißt“ man einfach auf alles, was sich nicht fügt, was sich nicht fügen will. Am Ende fährt man noch einmal zum See, um mit dem dementen, aber glücklichen Vater eine 200 € teure Flasche Cognac zu trinken und zu denken: „Scheiß drauf!“
Nis-Momme Stockmann, Jahrgang 1981, schreibt in diesem Text von seiner Generation, die über Dreißigjährigen, die von einem Rest Sehnsucht geplagt ist, wie sie der bürgerlichen „scheiß Verlässlichkeit“ entkommen kann. Diese Generation ist allerdings nicht mehr mit einem hinreichenden weltanschaulichen Instrumentarium ausgestattet, um sich gegen die Totenhausbürgerlichkeit zu wehren. Was das Programmheft als ein „mit knappen Strichen ein Bild der Generation 30+“ gezeichneten Entwurf rühmt, erscheint nicht selten als ohnmächtiges Stammeln. Da bedarf es schon der Poetisierung durch den willigen Betrachter, um einen ernstzunehmenden künstlerischen Anspruch im Text zu entdecken. Gelingt das nicht, sieht man sich einer lächerlich anmutenden Befindlichkeitsarie ausgesetzt, in dem sehr viel, zu viel „drauf geschissen“ wird. Es werden viele Fragen gestellt: „Was schuldet man sich selbst, was seinen Nächsten? Wie viel Freiheit kann, muss, darf man sich leisten? Was heißt Verantwortung? Wie lebt man und wie altert man in Würde?“ (Website Residenz Theater) Doch die Protagonisten „verschlucken sich meistens an den Worten, beißen Löcher in die Luft“. Antworten sind es jedenfalls nicht. Am Ende bleibt dem Zuschauer als Quintessenz ein wohliges Mitleiden mit der gebeutelten Generation, die sich durch ein diffuses Jammern definiert.
| |
 |
|
| |
Frederic Linkemann, Wolfgang Menardi, Arnulf Schumacher, Franziska Rieck, Martin Laue
© Thomas Dashuber
|
|
Wenn der Theaterabend, der wenig Erhellendes birgt, als künstlerischer Gestaltungsakt begriffen wird, dann durch die ambitionierte Inszenierung von Manfred Riedel und dem Spiel der Schauspieler. Bettina Kraus hatte eine Bühne geschaffen, die lediglich aus zwei schwarzen Wänden bestand und die durch das Verschieben die Szenenwechsel realisierten. Die Lösung war ebenso simpel wie verblüffend gut.
Im Zentrum des Geschehens stand durchgängig der Sohn. Wolfgang Menardi verlieh dieser Gestalt durch eine bis an die Grenzen gehende Intensität des Spiels etwas Zwingendes. Allein, häufig war seine Präsenz zwingender als der Inhalt, den er zu gestalten hatte und von dem mancher Zuschauer nicht recht wusste, worin er bestand. So wurden Befindlichkeiten am laufenden Band produziert. Es entstand viel emotionaler Lärm, - worum, das blieb eine Angelegenheit des Interpretationsvermögen des Betrachters. In der selben darstellerischen tränenreichen Haltung agierten Franziska Rieck als Exfrau Lisa und Martin Laue als Freund Ulf. Dabei oblag es dem Betrachter, sich an Hand der emotionalen Lage der dargestellten Personen etwas Sinnfälliges einfallen zu lassen, warum die Figuren in dieser desolaten Verfassung waren. Arnulf Schumacher ragte in Spielhaltung und Gestus auf beinahe kuriose Weise aus dem Gefühlsjammertal heraus. Obgleich er der Bedauernswerte war, die Demenz griff bereits nach ihm, er war von Ängsten geplagt und benötigte die Hilfe seines lebensuntüchtigen Sohnes, vermittelte diese Figur einen Rest an natürlicher, zweckfreier Lebensfreude selbst dort, wo keine mehr vermutet werden konnte.
In diesem Drama wurde auch ein großes antikes Thema angesprochen, die schmerzvolle und gelegentlich auch tödliche Überwindung des Vaters durch den Sohn. Dieser Anspruch wird deutlich, wenn sich der Sohn mit aller gebotenen Unterwürfigkeit am Ende um den Arbeitsplatz bemüht, den er durch eigenes Verschulden verloren hat. Sein Arbeitgeber hatte dasselbe Antlitz wie der leibliche Vater. So wurde die Vaterschaft auf einen größeren Bereich des Lebens ausgedehnt, als nur auf die Familie. Über den Sinn der Metaphorik kann man spekulieren. Doch eines ist unbestritten, die mentale und emotionale Verfassung der Generation 30+ bestürzt und erschreckt, wenn die Darstellung durch Nis-Momme Stockmann repräsentativ sein sollte!
Wolf Banitzki
Der Mann der die Welt aß
von Nis-Momme Stockmann
Franziska Rieck, Frederic Linkemann, Wolfgang Menardi, Arnulf Schumacher und Martin Laue
Regie: Manfred Riedel |
Marstall Wir kommen gut klar mit uns von Dorota Maslowska
Cineasie – Die Erlösung
Die junge Schriftstellerin Dorota Maslowska (Jahrgang 1983) macht den Unterschied deutlich zwischen jungen deutschen TheaterautorInnen, deren Saturiertheit (vornehmlich geistige) häufig nur Befindlichkeiten zu Tage fördern, und denen, die aus Ländern wie Polen oder Rumänien kommen. Mit „Wir kommen gut klar mit uns“ konfrontiert sie den Theaterbesucher in Deutschland mit dessen eigener eingeschränkter Sichtweise, die zumeist ein mediales Produkt ist. Heraus kommen Verstörung, Irritation und ein emotionales Mauern. „Was hat das mit uns zu tun?“, fragte sich wohl mancher Besucher der Vorstellung im Marstall. Mehr, als man gemeinhin wahrhaben möchte!
Wir Deutschen klopfen uns selbstgerecht auf die Schultern, weil wir in einer globalen Welt Exportweltmeister sind. Doch wollen wir nichts darüber wissen, woher das Geld kommt, mit dem der indische Mittelständler seine deutsche Nobelkarosse bezahlt. Es ist eine unumstößliche Tatsache, dass wir wieder Kolonialherren sind. Doch schützt uns das ach so segensreiche neoliberale System vor der moralischen Verantwortung. Und dann haben wir ja noch unsere einheimischen Handlanger vor Ort, die die Drecksarbeit für uns erledigen. Das und noch viel mehr sagt uns die junge Polin Dorota Maslowska mit ihrem aggressiven und emotional quälenden Stück über drei Frauen, die im Müll leben und darum nicht leben und die sich selbst als Müll begreifen.
Der Ekelfaktor ist hoch, obgleich deutlich auszumachen ist, dass es der Autorin nicht explizit darum ging. Das beweist nicht zuletzt ihre künstlerische Brechung, die in der logisch anmutenden Negation aller Vorgänge besteht, die letztlich sogar in der radikalen Infragestellung der Protagonistinnen gipfelt. Und um dem Ganzen die Zipfelmütze aufzusetzen, ist alles nur ein Film, der den schwachsinnigen Titel „Ein Pferd reitet“ trägt.
Den drei Frauen ist eine gemeinsame Grundhaltung eigen, die da lautet: „Ich lebe nicht! Nichts ist für mich!“ Das Erschreckende daran ist, dass ihre Realität ihnen gar keinen anderen Schluss anbietet. „Nicht Für Sie“, ist der Titel einer Reklamezeitung aus einem deutschen Verlagshaus, in dem die Frauen lesen können, was sie nicht kaufen, was sie nicht genießen, was sie nicht tun können. Und man hat sich eingerichtet damit, schwärmt darüber, wohin man nicht in den Urlauf fährt und zieht sich in das nichtexistierende eigene Zimmer zurück. Wirklich verrückt daran ist, dass dieser Lebensentwurf logisch ist und funktioniert, ja, sogar angenommen wird von denen, die ihn leben – oder besser, nicht leben.
Dorota Maslowska scheut sich dabei nicht, Namen und Hausnummern zu nennen von denen, die von diesem Elend profitieren. Dabei büßt das Stück keineswegs seine künstlerische Qualität oder seine Poetik ein. Vielmehr bekommen Namen wie Knorr oder Ikea einen Symbolcharakter, den man, das muss man sich einmal vergegenwärtigen, tatsächlich auf der ganzen Welt versteht. Und an dieser Stelle wird der Wahnsinn augenfällig, dass die menschliche Existenz längst aufgehört hat und die Existenz des Konsumenten begann. Der Konsumismus ist die erste Religion, die weltumspannend Besitz vom menschlichen Geist ergriffen hat. Der letzte Gott vor Moses (inzwischen der Lächerlichkeit preisgegebenen) Verkündigung feiert seine Reinkarnation: Das goldene Kalb. Das Wort Wahnsinn bekommt eine neue Bedeutung, denn der Sinn, der dem Wahn nach Wohlstand nachhängt, ist motivationsfördernd. Das wird jeder Coach, Guru, Heilsbringer - die Apologeten des neuen Glaubens - bestätigen. Der Glaube kann Berge versetzen, selbst wenn es nur Müllberge sind.
Inmitten dieses Müllbergs, zu dem Bühnenbildnerin Magdalena Gut die Spielfläche des Marstalls gestaltet hatte, thronte eine Frau, die scheinbar aus der Welt gefallen war. Jennifer Minetti, als „Trübselige Alte“ agierend, war die Keimzelle der „Arme-Frauen-Dynastie“. Für sie war die Zeit stehen geblieben, als deutsche Bomber im Zweiten Weltkrieg ihr Land, ihr Polen, in Asche verwandelten. Diese Asche verstreute sie immer wieder aufs Neue. Doch diese Asche düngt nicht in der postsozialistischen Gesellschaft. Sie bereitet nur Atemnot. Und plötzlich, als wäre sie aus einem Jahrhunderte währenden Alptraum erwacht, verkündete sie grotesk: „Ich bin keine Feministin“. Dieser nüchterne Satz verwandelte das sehr realistisch anmutende Elend in eine menschliche Tragödie. Für ihre Tochter Halina gibt es keine Hoffnung. Ulrika Arnold spielte sie Verzeihung heischend, als wäre ihr ihre eigene Existenz eine Schuld. Darin traf sie sich im Geist mit der Freundin Božena, „fett wie ein Schwein“ und stets darauf bedacht, nicht das Blickfeld der anderen Menschen zu verstellen. Franziska Rieck gab die Rolle clownesk und schuf ein erbarmungswürdiges Wesen. Einzig „Das kleine Metall-Mädchen“, Enkelin der „Trübseligen Alten im Rollstuhl“ könnte als Hoffnungsträger fungieren. Doch auch sie war gefangen in dem schicksalhaften Teufelkreis ohne erkennbare Chance. Grit Paulussen agierte aggressiv und fordernd, jedoch keinesfalls lieblos als Punk. Nebenbei, die Punks waren die letzten Aufbegehrer und Infragesteller, bevor die weitestgehend sinnfreie Massenkultur alle Poren der Gesellschaft besetzte.
| |
 |
|
| |
Thomas Gräßle
© Thomas Dashuber
|
|
In dieses Gruppenbild aus Frauen fiel plötzlich ein Filmemacher ein. Thomas Gräßle präsentierte sich mit erstaunlicher Präsenz und zwingender Agilität als der Schöpfer von „Ein Pferd reitet“. Darin ritt er über den Parcours des Elends der „Kleinen Leute“. Die Welt mochte das Elend der armen Sklaven unter den Bedingungen des „Realsozialismus“, ihr seelenrührender Kampf ums Überleben. In der inhaltlichen Überzeichnung kam allerdings zutage, dass Elend einen Unterhaltungswert hat, insbesondere für den, der es nicht kennt. „Slumdog Millonär“ lässt grüßen. Der Film „Ein Pferd reitet“ heimste alle Preise ein, die es gibt. Es folgten Reichtum, Drogensucht, geistige Impotenz und Talkshowauftritte. Ulrike Arnold moderierte mit dümmlichem Gesicht, spitze Lustschreie ausstoßend bei allen denkbaren und nicht denkbaren Banalitäten. Doch die Sache hat einen Haken. Der Film wurde nie produziert; nichts von alledem hat stattgefunden. Also schrieb der Regisseur weiter und schuf spätestens in der dritten Fassung ansehnliche (ZDF-taugliche) Helden. Der fetten Božena wurde ein neues Leben geschenkt. Als Monika entstieg Franziska Rieck dem Geburtsort und der Fettleibigkeit Boženas und wurde zu einer makellosen Barbie, die als rein künstliches Produkt über die Laufstege dieser Welt stolzierte.
In einer Welt, die nicht errettbar ist, gibt es gottlob immer eine cineastische Erlösung.
Am Ende, in der x-ten Fassung schlich sich jedoch ein böser Gedanke ein. Was, wenn die trübselige Alte bei dem Bombardement, von dem sie immer wieder faselte, getötet worden wäre?
Regisseurin Tina Lanik gelang mit dieser Inszenierung ein wirklich herausragender Wurf. Fast könnte man meinen, das Stück wäre für sie geschrieben. Die bissige Intelligenz des Textes, die Kompromisslosigkeit der Betrachtung, die nüchterne Poesie und das Fazit fand uneingeschränkten Widerhall in der szenischen Umsetzung. Frau Lanik verschenkte keinen Satz, kontrapunktierte präzise und schuf Brüche, die immer wieder überraschten. In ihr hatte die Vorlage von Dorota Maslowska eine Meisterin gefunden.
Es war ein fordernder und attackierender Theaterabend, doch wer offenen Geistes schaute, musste erkennen, dass es nicht zum Guten steht in dieser Welt. Die latente Bedrohlichkeit konnte den aufrütteln, der bereit war, sich aufrütteln zu lassen. Damit leisteten das Stück und die Inszenierung, was Kunst leisten sollte, auch wenn hier die ästhetische Kategorie des Schönen außen vorblieb. Wer den Mut hat, der wahren Realität, nicht der cineastischen ins Antlitz zu schauen, der sollte sich diese Möglichkeit nicht entgehen lassen.
Wolf Banitzki
DEA Wir kommen gut klar mit uns
von Dorota Maslowska
Deutsch von Olaf Kühl
Ulrike Arnold, Jennifer Minetti, Grit Paulussen, Franziska Rieck, Thomas Gräßle
Regie: Tina Lanik |