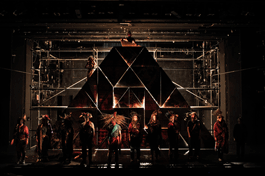Volkstheater Ghetto von Joshua Sobol
Spielen und Singen gegen den Tod
Joshua Sobol wurde 1939 als Sohn osteuropäischer Einwanderer geboren. Er studierte an der Pariser Sorbonne Philosophie und arbeitete als Lehrer in einem Kibbuz. Mit Stücken wie „Weiningers Nacht“ (1982) und „Ghetto“ (1984) errang er Weltruhm. Als er 1988 sein Stück „Das Jerusalem Syndrom“ zur Uraufführung brachte, kam es in Haifa, wo er vier Jahre lang das Theater leitete, und in ganz Israel zu Protesten und heftigen Auseinandersetzungen. Eine Aufführung in Tel Aviv wurde während der Vorstellung von den Rechten gestürmt und die Aufführung mit einer Lärmgranate attackiert. Sobol, der in dieser Zeit um sein Leben fürchtete, trat von seinem Amt als künstlerischer Leiter zurück und ging nach London, wo er sich ausschließlich dem Schreiben widmete. Er ist einer der heftigsten Kritiker der israelischen Politik. Und er ist ein permanenter Agitator für Gerechtigkeit, Vernunft und Frieden, was insbesondere bei der herrschenden Politik Missfallen erzeugt.
Das Drama „Ghetto“ erzählt vom Ghetto Wilna, dem heutigen Vilnius. Der von den Deutschen eingesetzte Ghetto-Polizeichef Gens kämpft mit allen Mittel darum, die jüdische Bevölkerung vor dem Zugriff der Faschisten zu schützen. Die Handlung beginnt in einer Zeit, in der von der jüdischen Bevölkerung, 1940 belief sich ihre Zahl noch auf 80.000, nur noch 16.000 übrig geblieben waren. Gens Widersacher ist der verantwortliche Offizier für jüdische Angelegenheiten in Wilna Hans Kittel. Doch Gens hat auch Widersacher in den eigenen Reihen. Kruk, der einstige Kommunist fordert von Gens den Aufstand gegen die Peiniger. Er prangert ebenso den Plan Gens an, im Ghetto ein Theater zu etablieren, dem der Schauspieler Srulik vorsteht. Durch diese Einrichtung erhielten die jüdischen Künstler Arbeitsscheine, die sie vor willkürlichen Hinrichtungen oder Abtransporten in das Tötungslager Ponary zumindest zeitweise schützten. Zu ihnen gehörte Sängerin Chaja. Als Vorlage für diese Figur diente Sobol die Sängerin Lyuba Levicka, die beim Schmuggeln von zwei Pfund Hafer und etwas Butter erwischt und hingerichtet wurde. Gens muss allerdings auch seinen Mitbürger Weisskopf unter Kontrolle halten, der eine profitable Uniformreparaturwerkstatt aufgezogen hat und seine Mitbürger auf schamloseste Weise ausbeutet. Gegen Gens arbeiten aber auch die Verhältnisse, denn Gens muss drakonische Strafen, auch Tötungen, an seinen Mitbürgern vollstrecken, wenn sie gegen die Gesetze im Ghetto verstoßen haben.
 |
||
|
Pascal Fligg, Robert Joseph Bartl © Arno Declair |
Gens kollaborierte, tötete eigenhändig und wurde am Ende selbst Opfer der Naziwillkür. Er führte einen aberwitzigen Kampf, um seinen jüdischen Leidensgenossen das Überleben zu ermöglichen. Die deutsche Gründlichkeit aber obsiegte. Nur sehr wenige Juden entkamen der Hölle des Ghettos.
Joshua Sobol erzählte die Geschichte ungeschminkt und frei von jeglicher Beschönigung. Der Grund, warum er dieses Stück so schrieb, wie er es schrieb, ist im Heute verankert. Sobol wollte ergründen, was die seelischen Verletzungen der Juden durch die Nazis zur Folge hatte. Er kam zu dem Schluss, dass das heutige Verhalten Israels, insbesondere der rechten Kräfte, durch eben diese Vorgänge im Dritten Reich, durch die Erniedrigung und Tötung von 6 Millionen Juden, das Resultat ist. So stellten sich die Israelis selbst das Mandat zum Töten aus. Der Kampf, den sie im Ghetto nicht führten, findet jetzt statt. Im Ergebnis dieses Kampfes wird willkürlich getötet und es werden Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. Sobol spricht damit etwas aus, was nicht politisch korrekt ist, da sich Kritik im Angesicht von 6 Millionen Opfern nicht schickt. Er lehnt die „Ausschwitzkeule“ vehement ab und plädiert für die Vernunft, die Probleme im Nahen Osten (und gemeinhin überall) miteinander zu lösen.
Obgleich alle Vorgänge im Stück durch die dokumentierte Realität abgesichert sind, kann man dieses Stück nicht rational erfassen, ohne emotional überwältigt zu werden. Dazu sind die Ereignisse zu unfassbar. Sie entziehen sich der menschlichen Vorstellungskraft. In Sobols Drama avancieren die Juden nicht zum „auserwählten Volk“, sie bleiben mit allen ihren Schwächen und Fehlern, wie man sie bei allen Menschen, egal welcher Religion, Weltanschauung oder Rasse findet, das Volk, welches von wahnsinnigen Politikern für die Ausrottung ausgewählt wurde. Das ist die bedeutendste Qualität dieses Stückes, die allerdings auch polarisiert, denn die ideologischen Verblendungen auf allen Seiten sind nach wie vor real.
Stefan Hageneier schuf für Christian Stückls Inszenierung einen düsteren Raum, der angefüllt war mit den Kleidern der inzwischen ca. 50.000 hingerichteten Juden. Der Tod bildete das Fundament für das Ringen um das Überleben. Schon das Bühnenbild ließ erkennen, dass es kein Entrinnen geben konnte. Es gab keinen einzigen Farbtupfer, alles war in Schwarz oder Grau gehalten. Es gab im Ghetto den Befehl, dass keine Blumen erlaubt seien. Gründlicher kann Perversion kaum sein. Vier Schauspieler stachen aus dem fabelhaft agierenden Ensemble heraus. Robert Joseph Bartl, er ist seit dieser Spielzeit Mitglied des Ensembles, spielte den Theaterleiter Srulik. Er schuf eine subtile Komik, die allerdings kein befreiendes Lachen provozierte, sondern das Grauen forcierte. Er war der eigentliche Gegenspieler zu Pascal Fligg Kittel, einer perfiden, diabolischen und pathologischen Sadisten. Fligg stellte in dieser Rolle die negative Großartigkeit des Bösen aus und er brillierte dabei in jeder Hinsicht. Sein Kittel war eine vielschichtige Persönlichkeit mit einer ausgeprägt sadistischen Intelligenz, ein teuflischer Spieler, stets darauf bedacht, sich selbst gut zu unterhalten. Johannes Meier gab seinen Gens kraftvoll und bestimmt, aber emotional verhalten. Vermutlich kam er damit dem wirklichen Gens nahe, denn wenn sich ein Mensch, der sich so Ungeheuerliches auflädt, auf seine Gefühle einlässt, kann er von diesen nur verschlungen werden. Er verkörperte eine gradlinige Respektsperson, der man weitestgehend folgte. Magdalena Wiedenhöfer verkörperte den einzigen weiblichen Part auf der Bühne, die Sängerin Chaja. Sie war den Begehrlichkeiten Kittels ausgesetzt, der schon mit dem ersten Satz das Damoklesschwert gegen sie zog. Sie sah sich schutzlos ausgeliefert und musste mit der permanenten Bedrohung leben, was unverhältnismäßig an ihren Nerven zerrte. Überleben konnte sie nur singend, und zwar in ihrer Muttersprache. In ihrem Gesang schwangen alles Leid und alle Sehnsüchte der Ghettobewohner mit.
Diese grandiose Inszenierung von Christian Stückl gehörte zu dem Bewegendsten, was in den letzten Jahren auf Münchens Bühnen zu sehen war. Das verdankte sie neben den großartigen Leistungen der Darsteller, dem trefflichen Bühnenbild und der gelungenen Einrichtung durch Regisseur Stückl auch der musikalischen Begleitung durch das Trio „Levantino“ (Michl und Max Bloching und Tom Wörndl). Ihre lebendige, direkte und melancholische Musik transportierte das jahrtausendealte Lebensgefühl der jüdischen Seele und nahm den Betrachter mit jedem Ton für sich ein. Dieser Abend, an sich unvergesslich, war ein Abend gegen das Vergessen (oder auch Verdrängen) von Geschichte und ein Mahnruf, endlich Vernunft walten zu lassen, ohne dabei ideologisch zu penetrieren. Es war ein Abend mit einer großen humanistischen Botschaft.
Wolf Banitzki
Ghetto
von Joshua Sobol
Robert Joseph Bartl, Pascal Fligg, Johannes Meier, Leon Pfannenmüller, Magdalena Wiedenhofer, Sohel Altan G., Ercan Karaçaylı, Benedikt Geisenhof, Martin Schuster
Regie: Christian Stückl