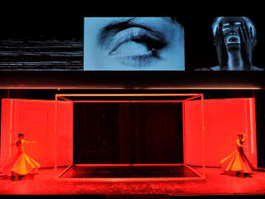Volkstheater Nystagmus - Eine große deutsche Kunstausstellung (UA) von Eyal Weiser
Wollt Ihr die totale Interpretation?
Nun, groß war sie nicht, die „große deutsche Kunstausstellung – Nystagmus“ auf der Bühne des Volkstheaters, konzipiert und in Szene gesetzt von dem Israeli Eyal Weiser. Doch ein Aufreger war und ist sie allemal. Und, entgegen allen Befürchtungen, es war Theater, das Bildende Kunst zwar zum Thema, aber nicht hauptsächlich zum Inhalt machte. Anders als üblich, wo jede verkaufte Karte auch Beleg für die haushalterische Daseinsberechtigung des Theaters gilt, wurden aus technischen Gründen ca. 300 Karten verkauft. So war der Zuschauerraum nur etwa zur Hälfte besetzt (2. Vorstellung). Schließlich mussten die Zuschauer zuerst auf die Bühne, wo sie einige Kunstwerke betrachteten. Die Kunstwerke sollen an dieser Stelle nur Erwähnung finden und nicht weiter beschrieben werden: Sybille Maria Lang: Zwei Barren Installation 2013-14; Ohad Fisher: One More Song, Video 2008; Dana Darvish: Rear View, Video loop 2012; Dana Goshen: Face Video loop 2012 und schließlich konnte auch noch der Performancekünstler Bruno Spatz („Mein Muttermund“) bestaunt werden. Bereits in diesem kurzen Rundgang wurde der Betrachter aufs Glatteis geführt, denn unter den Arbeiten befanden sich schon einige (artifizielle) Fakes.
Ausgangspunkt dieses Projektes war für Eyal Weiser die von Adolf Hitler 1937 veranstaltete Ausstellung „Entartete Kunst“ in deren Folge ein Großteil der Avantgardekunst aus der Öffentlichkeit verbannt und die Künstler mundtot gemacht wurden. Hitler hatte für die ästhetischen Abweichungen vom platten Realismus eine ebenso einfache wie blödsinnige Erklärung: Diese Künstler litten allesamt unter Nystagmus. Unter Nystagmus versteht man gemeinhin ein unkontrolliertes Augenzittern. Der Gröfaz meinte: Diese krankhafte Erscheinung verhinderte bei genannten Künstlern eine realistische Wahrnehmung. Es ist wahr und dennoch kaum zu glauben, dass es Menschen gab, die diesen Blödsinn glaubten und Hitler nicht augenblicklich als Psychopaten ausmachten. Einige der oben aufgeführten Werke wurden vom Kurator der Ausstellung Anton Ehrlich (Oliver Möller) präsentiert, um zu veranschaulichen, dass die Abstraktion von der Realität und die ästhetische Brechung Wahrheiten zutage fördern, die das Wesen des Gegenstandes ausmachen. Und das ist das Anliegen aller Kunst: Die Sichtbarmachung des Wesentlichen, das in der Erscheinung schlummert.
Und so begann die Performance mit der Erläuterung von Dana Goshens Video loop „Face“ durch den Kurator Anton Ehrlicher. Schon im Namen des Kulturbeauftragten und Wissenden verbarg sich eine emotionale Fußangel, steht der Vorname doch für den ersten Buchstaben des Alphabets. Mit ein wenig Mut könnte man hineininterpretieren, hier trat der erste auf, der grundehrlich ist, dem man vertrauen konnte. Oliver Möllers prägnante Stimme vermittelte tiefste Überzeugung. Allein, wer genau hinhörte, musste feststellen, dass der interpretatorische Bogen weit, sehr weit gespannt war, was an dem beeindruckenden und verstörenden Charakter des Videos nichts änderte. In jedem Fall hätte es sich auf Hitlers Liste wiedergefunden. Allein das Kostüm und die Frisur Möllers, er war von den Muslin Brothers gestalten worden, ließe vage Zweifel an seiner geistigen und emotionalen Seriosität aufkommen.
| |
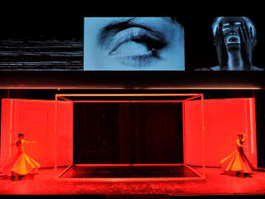 |
|
| |
Johannes Meier und Leon Pfannenmüller
© Arno Declair
|
|
In der zweiten Geschichte wurde die Familiensaga der Rein-Merchav-Familie erzählt. Sie beginnt mit der Malerin Emma, deren Aquarelle in Hitlers Ausstellung der „Entartung“ gezeigt wurden. Bei Emma diagnostiziert man eine Schizophrenie und 1944 wurde sie von den Nazis hingerichtet. Großvater Georg Rein war der SS beigetreten und avancierte in den Ostgebieten zum Massenmörder. Ihm gelang nach 1945 die totale Verdrängung und die Rückkehr in den bundesdeutschen Apparat als honoriger Richter. Doch die Vergangenheit holte ihn in Gestalt eines DDR-Stasioffziers ein, der Georg für den ostdeutschen Geheimdient mittels Erpressung rekrutierte. Er erfuhr die Erlösung in Form einer Alzheimer Erkrankung und schied bald hüben wie drüben aus dem Dienst und schließlich aus der Gesellschaft aus. Seine Tochter Helene ging, um die Schuld der Vater-Generation zu kompensieren und der rigiden BRD zu entfliehen, in einen Kibbuz nach Israel. Dort heiratet sie einen gewissen Merchav, der im Libanonkrieg fiel. Es folgen tiefe Depressionen.
Die Geschichte ist Fiktion; die ästhetische Umsetzung war beeindruckend. Während der Erzählung schuf Max Wagner, blond und deutsch, als wäre er einer Zwieback-Werbung aus den 50ern entsprungen, Bilder, in dem er mit einem schwarzen Band Punkte an den weißen Wänden verband. Es entstand das Bildnis der Malerin Emma, das ihm zum verwechseln ähnlich sah. Der Weggang nach Israel wurde dreidimensional, ein räumliches Gebilde, in dem sich Max Wagner schließlich verfing.
Diese fiktive Geschichte, die europäische Historie von fünfzig Jahren brachial herunterriss, steckte so voller Wahrheiten, dass ihre Ausformulierung Wahrheit gebar. Auch das ist eine wesentliche Eigenschaft von Kunst, nämlich die Wahrheit durch die Fiktion aufzuspüren. Über die Fiktion hinaus, nämlich in die Esoterik glitt die Geschichte von Sybille Maria Lang (Lenja Schultze) ab, die gemeinsam mit ihrer Mutter (Ursula Maria Burkhart), einem Medium aus Oberammergau, die Kunst (nach konkreten Anweisungen verstorbener Maler) und auch Wahrheit „channelt“. Wie es der Zufall wollte, war die Tochter des Deutsche-Bank-Chefs Jürgen Fitschen (Mara Widmann) in der Vorstellung. Sie arbeitet für die Kunstsammlung der Deutschen Bank und wünschte vom Medium zu erfahren, wo sich das Kruzifix von Ludwig Gies, wichtiger Bestandteil der Ausstellung Hitlers, verblieben war. Nebenbei spürt der Zuschauer deutlich, dass es hier um mehr ging, als den Erhalt eines Kunstwerkes. Tatsächlich erhielten viele Künstler durch Hitlers Diffamierung so etwas wie den Ritterschlag. Ihre Werke wurden nach dem Krieg zu Höchstpreisen gehandelt. Kunst als Wertanlage. Doch es meldete sich nicht Gries aus dem Jenseits, sondern ein gewisser Alois. Aus dem Mund von Ursula Maria Burkhart erklangen nun die letzten Worte von Jesus. Alois selbst war zum Kruzifix geworden, denn er war der von Hitler beklatschte Darsteller des Jesus in den Passionsspielen in Oberammergau. Eyal Weisers Seitenhieb auf den Missbrauch von Kunst durch die Esoterik und auf die Reduktion von Kunst auf ihren Marktwert saß. Frau Fitschen zog peinlich berührt und beleidigt von dannen, Anton Ehrlich versuchte stotternd die Situation zu retten und das Medium, alias Frau Burkhart meldete unverhohlen einen gesunden Hunger an.
„Werbeunterbrechung“ nannte sich das monumentale Video und die Performance der Sturm-Brüder (Johannes Meier und Leon Pfannenmüller), die sich wie Derwische im Kreis drehten, während Bilder aus der Werbung, aufreizend, verstörend und überästhetisiert auf das Publikum einhämmerten. Die Parallelen der heutigen Werbeästhetik zu der Ästhetik Leni Riefenstahls lassen sich kaum leugnen. Sie war eine wahrhafte Revolutionärin in Bezug auf Filmtechnik und kann wohl getrost als Mutter des Propagandafilms bezeichnet werden. Nichts anderes als Propaganda ist Werbung. Dabei ist der Inhalt des gesprochenen Wortes oder des Bildes völlig nebensächlich. Entscheidend ist, dass die Synapsen sich schütteln und die Marke so schnell wie möglich generalisiert wird. Nirgendwo ist Ästhetik so verlogen wie in der Werbewirtschaft. (In diesem Zusammenhang sei der Film „99 Cent“ von Jan Kounen empfohlen.)
Wer nun meint¸ Eyal Weiser könnte die Geschichte nicht noch toppen, der irrt, denn es ist immer noch der „Künstler als Irrläufer“, oder als Hybrid, wie Kurator Ehrlich ihn nennt, unbeachtet geblieben. Er ist der typische Bewohner der Szeneräume und hat im Grunde nichts als sich selbst anzubieten. Sein Name ist Bruno Spatz, der mit seiner Performance „Die Nabelschnur“ einiges Aufsehen erregte, während er an der UdK in Berlin studierte. Selbstredend ist auch dieser Mann ein Fake, doch er verkörpert einen Typus und Ideen, die virulent aus dem Boden schießen wie Pilze nach einem warmen Regen. Es sind die Menschen im Prozess der „Selbstfindung“, die in ihrer Orientierungslosigkeit den Künstler in sich entdecken. Und so ist Bruno Spatz, mit einem grandiosen Jean-Luc Bubert besetzt, eine lächerliche Figur, die, um sich halbwegs effektvoll selbst in Szene zu rücken, bis zum Äußersten gehen muss. Angefeuert von seiner Muse und Lebenspartnerin Magdalena Wiedenhöfer, verkaufte er seine sämtlichen Ausscheidungen als Kunst. Es ist doch, und daran besteht kein Zweifel, nur eine Frage der Interpretation. Und so eskalierte der Abend in dem hysterischen Schrei Wiedenhöfers: „Wollt ihr die totale Interpretation?“ - und die lautlose, reflexartige, weil aus dem Fleisch und dem Blut kommende Antwort war unüberhörbar: Ja!
Dieser Abend war eine wahrhaft gelungene Kritik an der Kunst, die sich durchaus selbst im Wege stehen kann; am Kunstapparat, der vornehmlich verhindert; am Kunstmarkt, der Kunst profanisiert; an der Kunstkritik, die sich in ihrer totalen und totalitären Kritik gefällt; an der Politik, die Kunst immer wieder zur Hure macht und am Kunstpublikum, das endlich einmal mündig werden sollte. Mündig bedeutet nicht, auf das unverbrüchliche Recht zu beharren, die Vorstellung vorzeig verlassen zu können, wenn es beliebt, sondern sich den Vorgängen zu stellen.
Auch die Frage, ob Kunst sich von Ideologien emanzipieren kann, wurde gestellt. Die Antwort ist zwiespältig und kann auch nicht letztgültig gegeben werden. Es gibt Kunst, die leider ohne Ideologie keine Inhalte hat. Es gibt aber auch Kunst, die mit allen Inhalten bricht und Weltanschauungen hervorbringt. Leider werden diese Wahrheiten immer wieder von der Mittelmäßigkeit okkupiert und alsbald in Ideologien umgewandelt. In der Kunst ist es wie im wahren Leben: Mal so, mal so.
Es wäre schön, wenn diese Arbeit von möglichst vielen Zuschauern angenommen würde, denn sie ist in erster Linie ein Diskussionsangebot. Und Diskussion ist ein Wort, was man heutigentags viel zu selten im Zusammenhang mit dem Theater hört. Wie soll sich da Theater und Kunst im Allgemeinen entwickeln? Eines hat uns immerhin Eyal Weiser voraus. Er leidet unter der konservativen Verkrustung der Kunst in Israel. Aber das macht ihn richtig bissig.
Wolf Banitzki
Nystagmus - Eine große deutsche Kunstausstellung (UA)
von Eyal Weiser
Jean-Luc Bubert, Ursula Maria Burkhart, Johannes Meier, Oliver Möller, Leon Pfannenmüller, Lenja Schultze, Max Wagner, Mara Widmann, Magdalena Wiedenhöfer
Regie: Eyal Weiser
Fotografie und visuelles Konzept: Rami Maymon
|
Volkstheater Die Räuber nach Friedrich Schiller
Kein Beitrag zur Schillerrezeption
In Schillers dramatischem Debüt erzählt der junge Rebell Schiller die Geschichte der Familie Moor, die von Rebellion und Intrige zerstört wird. Karl, der Erstgeborene, ein leichtfüßiger Student, macht in Leipzig Schulden und geht den Vater um Hilfe an. Der Strahlemann ist von der Natur reichlich gesegnet. Er ist ansehnlich und er hat Verstand. Doch er „ist eine verirrte große Seele“. Franz, der Zweitgeborene, hadert mit seinem Schicksal, begehrt auf und will sich des Bruders und mit ihm auch gleich des Vaters entledigen. Franz muss die Bürde der Hässlichkeit tragen, eine Laune der Natur. Doch er akzeptiert sein Schicksal nicht: „Ich will alles um mich her ausrotten, was mich einschränkt dass ich nicht Herr bin.“
Im Hause Moor lebt Amalia, die Braut Karls. Franz Augenmerk gilt neben dem familiären Besitz auch ihr. Also fälscht Franz, der auch Kain heißen könnte, Briefe. Er bringt den Bruder, der in die Rolle des Bruders Abel gezwungen wird, beim Vater in Misskredit. Karl wird verstoßen und Räuber. Dann kommt die gefälschte Nachricht seines Todes, was den Vater zerschmettert. Franz sperrt diesen klammheimlich weg, erklärt ihn für tot und übernimmt die uneingeschränkte Herrschaft. Amalia, auf romantische Weise ihrer Liebe zu Karl verpflichtet, bleibt standhaft und wird letztlich einem militärischen Schwur Karls geopfert. Die Wahrheit ist jedoch nicht zu unterdrücken und holt den Bösewicht Franz ein. Der legt Hand an sich an und stielt sich aus dem Leben. Karl steht vor den Scherben dessen, was einmal seine Familie war.
Natürlich greift die Geschichte weiter, als hier in Kürze beschrieben, denn es gibt den Kosmos der Räuber-Bande, durchaus ein Ebenbild der Gesellschaft, in der Machtkämpfe ausgefochten werden und in der intrigiert wird. Auf tragische Weise kommen Menschen zu Tode, unschuldige Menschen. Schuld türmt sich auf, wie ein Faltengebirge und versperrt den Weg in die wirkliche Freiheit. Doch darauf verzichtet die Inszenierung von Sebastian Kreyer am Münchner Volkstheater weitestgehend. Diese (notwendigen) Zutaten werden nebenher eingeflochten, wie im Schillerschen Text vorgegeben, nur knapper. Und so steht man nach zwei und einer halben Stunde einem über weite Strecken peinlichen, langatmigen und somit ärgerlichen Drama ziemlich ratlos vis-à-vis und ist verzweifelt. Was wollte uns diese Lesart mit auf den Weg geben? Wenn der Kritiker in seinem Vermögen überfordert ist, eine schlüssige Interpretation zu finden, greift er zum Programmheft, denn darin versucht der Dramaturg zumeist einige Fährten zum besseren Verständnis zu legen.
| |
 |
|
| |
Mara Widmann
© Arno Declair
|
|
Auf der Suche nach Hinweisen stößt man in einem kritischen Safranskitext auf das Wort Subordination. Für Schiller ist diese Haltung das Ergebnis aus einer Erfahrungsarmut, wie er sie selbst im militärischen Dienst erlitten hatte. Sein Text „Die Räuber“ ist das Kind aus dem Beischlaf des Genius mit der Subordination. Subordination hat nur eine Begehrlichkeit: Freiheit. Karl Moor: „Das Gesetz hat noch keinen großen Mann gebildet, aber die Freiheit brütet Kolosse und Extremitäten aus.“ Nun, das ist nicht neu, wenngleich dieser alles überstrahlende Satz in Kreyers Inszenierung weder hinreichend vorbereitet, noch herausragend dargeboten wurde. Er verpuffte. Schnell wurde klar, in Kreyers Lesart ging es mehr um das Individuum, als um seine gesellschaftliche Stellung und so ließ die Strichfassung vornehmlich die Befindlichkeiten, die Selbstreflexionen übrig. Das hatte zur Folge, dass man (bei Unkenntnis des Schillerschen Textes – heute keine Seltenheit) schnell den Überblick verlor. Unlogik allenthalben. Das faszinierendste Paradoxon war die Auferstehung des Maximilian von Moor, der wie Kai aus der Kiste, resp. wie Max aus der Wand kam.
Selbst wenn man nicht allzu pingelig an die Geschichte geht, blieb unübersehbar, dass jegliche Ernsthaftigkeit, die bei diesem Thema durchaus angeraten ist, von billigen, manchmal auch beachtenswerten szenischen Gags überlagert war. Die Sucht nach dem Lacher ist symptomatisch in der heutigen Zeit. Ist es die selbstzerstörerische (oder werkzerstörerische – für einen Regisseur ist das ein und dasselbe) Sucht auch? Safranski zählte in seinem Text (Subordination und das Genius) viele Schwächen des Dramas und der damit verbundenen Schillerschen Denkungsart auf und es entstand der Eindruck, dass Sebastian Kreyer unbedingt daran gelegen war, eben diese Schwächen sichtbar zu machen. Ein einheitliches und schlüssiges Konzept wurde jedenfalls nicht sichtbar. Die bei Schiller nicht verknüpften Handlungsstränge wurden bei Kreyer zu Absurditäten aufgeblasen. Popsongs von Emmylon Harris bis Kate Bush banalisierten das große, ernste Thema soweit, dass selbst Erdnussflips zu Botschaftern werden konnten. Auch vor der Sprache machte die Banalisierung nicht Halt. („Lass meinen Pimmel los!“)
Matthias Nebels Bühne wies Elemente auf, die zusätzlich verwirrten. Was bedeuteten die aufgebäumten mit Helium gefüllten Ballonpferde an der Rückwand? Ein Ferrari-Fanshop vielleicht? Oder bedeutete Aufbäumen einfach nur Aufbäumen? Das auf der Drehbühne aufgebaute Räubercamp, bestehend aus Paletten, und dessen tiefere ästhetische und philosophische Bedeutung wurde immerhin durch den Text „Anmerkungen zu Camp“ von Susan Sonntag zu erklären versucht. „Nicht um Schönheit geht es dabei, sondern um den Grad der Kunstmäßigkeit, der Stilisierung.“ Scheinbar sind auch die am Aussterben, die jemals ein militärisches Lager oder Camp am eigenen Leib erfahren haben. Die ganze Geschichte war so brüchig wie aufgeblasen, und dementsprechend verloren waren die Darsteller darin. Allen voran Max Wagner als Karl. Er hatte zumeist damit zu tun, sich selbst zu zerfleischen, sein Hirn zu martern und widerwillig, aber hinreichend konsequent seine blutige Spur zu ziehen. Die konzeptionelle Konfusion verhinderte klare Konturen. Wagner spielte nicht die Figur Karls, sondern dessen widerstreitenden Geist.
Jakob Gessners Aufgabe bestand darin, die gesamte (auch widerstreitende) Räuberbande zu ersetzen. Maria Roers stattete die Darsteller mit Unterwäsche aus: Weiß für zivil und Grün für militärisch. Dass die Beziehung zwischen den Kameraden und Karl homoerotisch wurde, lässt sich (nicht unbedingt schlüssig) über den Programmhefttext „Aufbrüche“ von Klaus Theweleit erklären: „Die Bewegung hin zum Soldaten wird als Bewegung weg von der Frau dargestellt.“ Legitim sind derartige Ansätze wohl, zwingend nicht. In jedem Fall isolierte diese Konstellation die Figur der Amalia und so verkam Mara Widmanns Aufgabe ein wenig zu der eines Nummerngirls. Nett und lustig anzuschauen war sie allemal. Einzig Oliver Möller gelang es, den Bösewicht Franz in das rechte Format zu bringen. Möllers Gestaltungskraft überwand die Formlosigkeit des Gesamtwerkes und hinterließ einige einprägsame Bilder und Sätze. Sehr seltsam mutete dagegen die Figur des alten Moors an. Paul Fassnacht kam mit Sonnenbrille und Fellmantel daher wie ein Vorstadtpate, der nebenbei „ein bisschen Schotter, Asche, Kohle“ machen musste. So knatterte er sich durch seine wenigen Szenen und verschwand nebst Klappbett in der Wand, um zum Ende ebenso peinlich knatternd wieder aufzuerstehen.
Nein, diese Inszenierung leistete sicher keinen bedeutsamen Beitrag zur Schillerrezeption. Ebenso wenig konnte sie konzeptionell und ästhetisch überzeugen. Schade, denn allzu häufig verkommen die klassischen Werke der Dramenliteratur zu Experimentierfeldern überambitionierter und respektloser Herangehensweisen. Wie wäre es stattdessen mal wieder mit einem lustigen Goldoni oder Moliére?
Wolf Banitzki
Die Räuber
nach Friedrich Schiller
Paul Fassnacht, Jakob Gessner, Oliver Möller, Max Wagner, Mara Widmann
Regie: Sebastian Kreyer