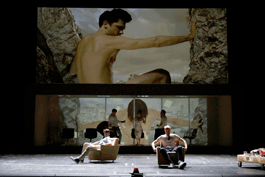Residenztheater Vor dem Ruhestand von Thomas Bernhard
Der Schoss ist fruchtbar wieder
7. Oktober. Es ist der Geburtstag des Reichsführers SS Heinrich Himmler. Wie jedes Jahr steigt Rudolf Höller nach getaner Arbeit, er steht kurz vor dem Ruhestand, in seinen Keller hinab, wo er von seinen Schwestern Vera und Clara erwartet wird, um seine SS-Uniform anzuziehen und dem „genialen“ Geistesgenossen zu huldigen. Nach dreihundertvierundsechzig Tagen ideologischer und emotionaler Enthaltsamkeit ufern die Rituale aus. Da schwelgt man in nationalsozialistischem Kitsch, in Erinnerungen an die Begegnung mit dem Reichsführer SS im Lager, in dem Höller Dienst tat, und wenn der Sektkonsum fortgeschritten ist, geht’s richtig zur Sache. Dann muss die linksbolschewistische, an den Rollstuhl gefesselte Schwester Clara die gestreifte KZ-Uniform anziehen, während Vera sie kahl schert. Das erregt Rudolf dermaßen, dass er nicht an sich halten kann und er besteigt Schwester Vera.
Tina Laniks Inszenierung von Thomas Bernhards „Rachekomödie“, die 1979 am Staatstheater Stuttgart uraufgeführt wurde, feierte im Residenztheater eine Wiederauferstehung. Nicht nur, dass die Ideen des Nationalsozialismus in der deutschen Gesellschaft eine Renaissance erleben, der Zuschauer kann mit Erstaunen feststellen, dass die braune Mentalität gar keine temporäre Erscheinung, sondern, wie der rechte Ideologe Götz Kubitschek beteuert, deutsche Wesensart ist. Diese, sich aller rationalen Argumentation entziehenden Aussagen werden in Bernhards Stück und vor allem in Tina Laniks Lesart durchaus gespiegelt. Damit hat Bernhard etwas vorweggenommen, was vor vierzig Jahren, als das Stück entstand, kaum vorstellbar war. Gemeint ist das „Wiedergängerhafte“ der nationalsozialistischen Ideologie und ihrer Protagonisten, und zwar in durchaus neuem Gewand. So zeigt sich, dass die „Übermacht der Erinnerung“, wie Kubitschek das zwingende Moment der deutschen Geschichte nennt, ein Gespenst ist, das quicklebendig und entwicklungsfähig ist.
| |
 |
|
| |
Charlotte Schwab, Götz Schulte, Gundi Ellert
© Andreas Pohlmann
|
|
Frau Laniks Inszenierung begann mit der Auferstehung der drei Figuren des Stücks, die staubbeladen an der Rampe lagerten. Sie sind historische Untote, die von der Rede Götz Kubitscheks auf einer Legida-Kundgebung, gehalten am 21. Januar 2015 in Leipzig, erweckt wurden. Der eiserne Vorhang hob sich bis zur Hälfte und gab einen schwarzen Raum frei. Eine Leiter zeigte an, dass es sich um einen tief gelegenen Kellerraum handelte (Bühne: Maximilian Lindner). Darin standen zwei große schwarze Kisten, in denen alle die Artefakte, Bilder und Kleidungsstücke fein aufgeräumt lagerten, die für die makabere Gedenkfeier vonnöten waren. Ein großes Porträt von Himmler wurde aufgestellt und die geschwätzige Eva, von einer überaus agilen Gundi Ellert gespielt, schwärmte, erklärte, verklärte und verteidigte die Rituale und auch die Ideen, die dahinter standen. Charlotte Schwabs Clara war eine Gefangene, und zwar in jeder Hinsicht. Sie war an ihren Rollstuhl gefesselt und daher jeglicher eigenbestimmter Bewegung beraubt. Zudem hatte sie sich von der geschwisterlichen Ideologie losgesagt, was sie zum Feind schlechthin machte. Dementsprechend ging man mit ihr um. Selbst eine Hinrichtung war denkbar. Charlotte Schwab schüttete immer wieder ihr homerisches Lachen über die Erbärmlichkeit Rudolfs und der in inzestuöser Notgemeinschaft gefangenen Schwester Eva aus. Clara wurde nicht nur verbal traktiert. Götz Schultes Rudolf wurde schnell und ohne Vorwarnung handgreiflich. Er war längst an seinen, zum Selbstschutz errichteten Grenzen, angelangt und drohte permanent, die Kontrolle zu verlieren. Der bekennende SchutzStaffler lobte einerseits seinen noch immer beträchtlichen Einfluss, der allemal ausreichte, um im Stadtrat eine Chemiefabrik vor seiner Haustür zu verhindern. Er lebte andererseits aber auch seinen tiefen Groll gegen Gesinnungsgenossen aus, deren Opportunismus gegenüber den „demokratischen“ Verhältnissen für Rudolf gleichbedeutend mit Selbstverleugnung, mindestens aber Gesinnungslumperei war. Die Erinnerungen wurden allerdings auch sehr konkret, als Eva eine Fotoschau machte. Da wurden Begegnungen mit den Nazigrößen beschworen, Fronturlaube in schönen europäischen Städten, aber auch Judenhinrichtungen auf kleinstädtischen Marktplätzen. Die Verklärung der Geschichte war inzwischen so vollkommen, dass differenzierte Emotionen dazu nicht mehr aufkamen. Nur der Verlust und die Klage darüber blieben übrig.
Gänzlich frei von Schamgefühl und ermutigt durch die unerschütterliche, geradezu mythologische Gewissheit, das Richtige zu vertreten und zu tun, breiteten sowohl Rudolf, wie auch Eva ihre degenerierte Denkungsart aus und der Zuschauer musste erkennen, dass nicht wenige Ansätze im heutigen Polit-Sprech längst wieder geläufig und sogar hoffähig geworden sind. Es drängten sich die Einsichten auf, dass bestimmte, ideologisch gewandete Forderungen des Umweltschutzes, etliche Appelle der Kapitalismuskritik oder viele Ansprüche nach ethnischer Isolation, wie sie heute allzu leicht formuliert werden, deckungsgleich mit den Forderungen der Nazis von vor achtzig Jahren sind. In diesem Augenblick wird deutlich, wie weit der Vormarsch dieser stupiden Gesinnung schon gelungen ist und wie nahe uns die Nazis schon wieder kommen. Wenn Rudolf gegen Ende des Stücks den Tag beschwört, an dem sie sich in ihren geistigen und stofflichen Uniformen in der Öffentlichkeit wieder frei bewegen können, wird deutlich, dass er eigentlich schon gekommen ist.
Als Brecht schrieb, „der Schoss ist fruchtbar noch, …“ nahm man diese Worte als gelungenen poetischen Vers. Wenn Tina Lanik am Ende des Stücks eine große rote Fahne mit Hakenkreuz herabsenkt, wird deutlich, dass Brecht durchaus wörtlich genommen werden kann. Das Premierenpublikum bekannte sich deutlich und überschwänglich zur Botschaft der Inszenierung. Der von zahlreichen Bravos durchsetzte Applaus war fast schon eine Demonstration. Er galt darüber hinaus aber auch der darstellerischen Leistung dreier exzellenter Schauspieler. Vielleicht hätte man sich mehr stimmgewaltige Einsprüche von Seiten Charlotte Schwabs gewünscht. So wäre das Spiel nicht gar so grotesk eskaliert. Doch die sah Bernhards Text nicht vor. Der Aktualität und der Wirkung tat es keinen Abbruch. Bleibt vielmehr zu hoffen, dass die Stimmen des Widerstandes und der Vernunft in der Gesellschaft nicht verstummen. Noch sind sie nicht in der Unterzahl.
Wolf Banitzki
Vor dem Ruhestand
von Thomas Bernhard
Gundi Ellert, Götz Schulte, Charlotte Schwab
Regie: Tina Lanik
|
Residenztheater Hexenjagd von Arthur Miller
Gesunder Realismus
Arthur Miller war Moralist, einer, der daran glaubte, mit Theater und Literatur die Welt verändern zu können. So verfolgen seine Dramen stets eine „Nutzanwendung“ (Friedrich Luft). Diese Haltung verwundert kaum, schaut man sich die Biografie des Enkels mittelloser österreichischer Einwanderer an. In sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen, arbeitete er als Lehrling in einem Auto-Ersatzteillager. Miller bekam 15 Dollar die Woche, lebte von 2 und sparte 13 Dollar für ein Studium. Neunzehnjährig hatte er genug zurückgelegt, um ein vierjähriges Studium am Theater-College der Universität Michigan zu absolvieren. 1938 kam er nach New York, wo er sich als freier Schriftsteller durchschlug. Im „Dramatic Workshop“ lernte er Tennessee Williams kennen, dessen psychologisch-poetische Dramatik den denkbar krassesten Gegensatz zu den Stücken Millers darstellte. Mitentscheidend für Millers literarische Ausrichtung war der 1938 aus Deutschland emigrierte Erwin Piscator, einer der wichtigsten Vertreter des linken Agitationstheaters der 20er und 30er Jahre, der im „Dramatic Workshop“ lehrte. Mit „Tod eines Handlungsreisenden“ (UA 1949) stieg Miller in die Oberliga der Weltdramatik auf. 1957 wurde der Dramatiker, der freimütig seine Sympathien für den Kommunismus preisgab, vom „Kongressausschuss für unamerikanisches Verhalten“ zu einem Monat Gefängnis und 500 Dollar Geldbuße verurteilt. Er hatte sich geweigert, Aussagen über frühere Bekannte zu machen, die im Verdacht standen, Kommunisten zu sein. Er selbst hatte dem Staatskommunismus russischer Prägung alsbald den Rücken gekehrt. Sein Kommentar dazu: „Ich musste zur Hölle gehen, um den Teufel zu treffen.“
Miller selbst zitierte die stalinistischen Schauprozesse als Anlass für sein Drama „Hexenjagd“. Das war allerdings zum Teil auch eine Schutzbehauptung, denn, sich in dieser Zeit mit Senator MacCarthy anzulegen, der dem „Kongressausschuss für unamerikanisches Verhalten“ vorstand, wäre selbstmörderisch gewesen. Dennoch waren die Parallelen unübersehbar. Als Folie für sein 1953 in New York zur Uraufführung gelangtes Drama waren die Dokumente zu den Hexenprozessen in Salem, Massachusetts, die erst durch Millers Stück zweifelhaften Weltruhm erlangten. Miller weilte an einem kalten Frühlingstag im „Hexenmuseum“ der Historischen Gesellschaft von Salem und betrachtete die Kupferstiche und Holzschnitte, die 1692 während der Gerichtsverhandlungen zur medialen Verbreitung der Ereignisse entstanden waren. „Die Bilder zeigten die Vorgänge in Salem, damit man in Boston und anderen entlegenen Orten eine Vorstellung aus erster Hand davon bekommen sollte, wie wahnwitzig die Menschen sich unter den Einflüsterungen und Versuchungen der Hexen verhielten. Dargestellt waren die betroffenen unschuldigen Mädchen, die voll Entsetzen mit dem Finger auf die Frau eines Farmers deuteten, die sie insgeheim mit ihren Zauberkräften verfolgte, aber den christlichen Anschuldigungen mit stolzer Verachtung die Stirn bot. (…) Die Lichtstrahlen (eines Feuers – W.B.), die die Szene erhellten, standen in scharfem Kontrast zu den dunklen, unheimlichen Schattenzonen.“ (Arthur Miller: Zeitkurven)
Dieses Bild könnte Stefan Hageneier für seine Bühne und auch die Kostüme inspiriert haben. Der gesamte Bühnenraum war in verschlissenem, fadenscheinigem Schwarz gehalten. Säulen deuteten sowohl die Kirche, als auch den städtischen Versammlungsraum an, in dem Gericht gehalten wurden. Transparente Zwischenwände verwandelten die Szene in Wohnhäuser oder auch in einen Folterkeller. Ausgeleuchtet (Licht: Gerrit Jurda) wurde so, dass stets „unheimliche Schattenzonen“ entstanden oder blieben. In einer dieser Schattenzonen hatte Regisseurin Tina Lanik die Musikerin Polly Lapkovskaja (Polly Ester) in archaisch düsterem Gewand platziert. Mit ihrem schaurig-schönen Beschwörungsgesang (Im Stück der Gesang der schwarzen Sklavin Tituba, von einer grandiosen Valentina Schüler gespielt.) machte sie jene abergläubischen Triebkräfte sphärisch hörbar, die Auslöser der Geschichte waren.
| |
 |
|
| |
Sibylle Canonica, Thomas Loibl
© Thomas Aurin
|
|
Eine Schar Mädchen hatte sich im Wald versammelt, um zu tanzen, um sich für den Augenblick der Zwänge zu entledigen, die in der schottisch-puritanischen Kirche Neuenglands Gesetz waren. Abigail Williams, von Valery Tscheplanowa als fleischgewordener unbeugsamer Hass gespielt, trachtete Elizabeth Proctor, Sibylle Canonica als ein Sinnbild fast überirdischer Reinheit, nach dem Leben. Abigail hatte mit John Proctor, fulminant von Thomas Loibl gespielt, dessen Ehe gebrochen. Unter Puritanern eine Todsünde. Proctor kann nur um den Preis der Selbstauslöschung verhindern, was kommen sollte. Reverend Parris ertappt die Mädchen bei ihren nächtlichen Ritualen im Wald. Jörg Lichtenstein spielte den Pastor als einen zutiefst bigotter Mann, der in seinem Amt eher die Macht und den Zugang zu materiellen Gütern sieht, als eine göttliche Berufung im Dienst am Glauben. Der Schock bei den Mädchen ist gewaltig. Sie reagieren mit Ohnmacht oder Hysterie. Schnell kommt die Vermutung auf, der Satan hätte seine Hand im Spiel. Reverend John Hale, ein erfahrener Mann in Fragen Exorzismus, wird gerufen. Thomas Lettow gibt einen Geistlichen mit ehrenhaften Absichten, dem Zweifel an seinem Tun nicht unbekannt sind. Als die Mädchen merken, dass ihnen die Vermutungen, sie seien mit dem Teufel im Bund, als wohlfeile Ausrede dienen kann und sie durch ein Geständnis straffrei ausgehen würden, löst sich eine Lawine von Verdächtigungen, Denunziationen und Verleumdungen. Angesichts der Vielzahl derer, die mit dem Teufel um Bund zu sein scheinen, reagiert Kirche und Justiz total hysterisch und Salem wird zum Kreuzzugsort.
Bald sitzen mehr als vierhundert Menschen im Gefängnis; Reverend Parris hat mehr als siebzig Todesurteile unterschrieben, als ihm ernsthafte Zweifel kommen. Doch Staat und Kirche in Person Danforths, Stellvertreter des Gouverneurs, den Norman Hacker ganz und gar als unbeugsamen und zweifelsfreien Machtmenschen gestaltet, und Reverend Parris halten mit despotischer Sturheit an ihrer Aufgabe fest. Selbst als für jedermann sichtbar wird, dass der Wahnsinn regiert, gibt es kein Erbarmen. Es wird deutlich, dass die vermeintlich religiösen Motive der Denunziationen längst umgeschlagen sind in blanke Rache, in die Beseitigung von unliebsamen Mitmenschen und Besitzgier. Ungeachtet dessen wird hingerichtet. Dabei waren es die Opfer, die zur Hölle gingen, um dem Teufel zu begegnen. Der ganze Wahnsinn, in den die Menschheit unter argumentativer Mithilfe von Religionen immer wieder aufs Neue stürzt, und der immer wieder in Blutvergießen gipfelt, wurde in diesem Drama offenkundig. Bei genauerer Betrachtung kann man durchaus zu dem Schluss kommen, dass Religionen im Grunde Geisteskrankheiten sind, die in Intervallen immer wieder ausbrechen und entarten wie Krebsgeschwüre.
Bereits nach der deutschen Uraufführung am Schillertheater 1954, der kalte Krieg tobte seinerzeit, klagte die Kritik über den ideologischen Charakter des „Zeigefinger-Theaters“ von Miller, der sich Mittel bediente, die, wie selbst Friedrich Luft meinte, längst abgedroschen waren. Selbstredend muss zumindest teilweise zugestimmt werden, wenn Millers Stück „Thesentheater“ genannt wird, was bedeutet, dass Ideenträger auf der Bühne unterwegs sind und weniger Menschen aus Fleisch und Blut. Der permanente Zeigefinger würde den Blick auf die menschlichen Wesen verstellen, so der Vorwurf der Kritik. Wenn man aber die Inszenierung von Tina Lanik am Residenztheater erlebt hat, werden diese Einwände nebensächlich. Zugegeben, nur zwei Protagonisten durchlaufen eine echte Entwicklung. Thomas Loibls John Proctor ging einen von Zweifeln gepflasterten Weg in die Wahrheit, die ihm am Ende das Leben kostete. Er war geläutert und nicht bereit, seine Würde vor den Augen der ganzen Welt an die Kirchentür nageln zu lassen. Und Thomas Lettows Reverend John Hale plädierte zuletzt aus reiner Menschlichkeit für den Meineid, um das Leben der Menschen zu retten. Doch es waren eben jene „guten Christen“ die auch um den Preis des Todes ihren Gott nicht verkauften. Die vermeintlich Göttlichen entpuppten sich als satanisch und die Satanisten waren die von Gott beseelten. Wer vermag es, die Parallelen zur heutigen Welt nicht zu sehen?
Millers Wahrheiten, seine Argumentationen sind so zwingend, dass man an ihnen wachsen kann, auch im Umgang mit der Realität, was schlicht und einfach bedeutet, dass Theater uns verändern, klüger und gefestigter machen kann. Wenn wir die Vernunft nach außen hin vertreten, wird die Welt ganz sicher ein stückweit besser. Und vielleicht steckt darin eine Hoffnung, dass irgendwann nicht mehr im Namen Gottes und zu seinem Schutz oder für seinen Glanz und seine Herrlichkeit erniedrigt, gefoltert, verstümmelt oder gemordet wird.
Tina Laniks vom Premierenpublikum zu Recht gefeierte Inszenierung hat große „nutzanwenderische“ Potenzen; Gesunder Realismus, der trotz oder vielleicht wegen seines didaktischen Anspruchs bewegt! Lob und Dank dafür.
Wolf Banitzki
Hexenjagd
von Arthur Miller
Jörg Lichtenstein, Friederike Ott, Valery Tscheplanowa, Genet Zegay, Juliane Köhler, Wolfram Rupperti, Valerie Pachner, Thomas Loibl, Ulrike Willenbacher, Michele Cuciuffo, Thomas Lettow, Valentina Schüler, Sibylle Canonica, Simon Werdelis, Norman Hacker, Arnulf Schumacher, Polly Lapkovskaja
Regie: Tina Lanik