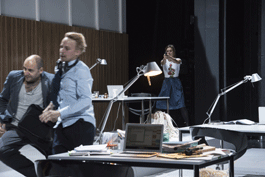Residenztheater Heilig Abend von Daniel Kehlmann
Gut, dass wir drüber geredet haben
Was macht eine gelungene Fiktion aus? Eine gelungene Fiktion ist eine frei erfundene Geschichte, deren äußere Umstände, deren innerer Ablauf und deren Psychologie der Protagonisten so logisch sind, dass die Geschichte tatsächlich so passiert hätte sein können. Die Inszenierung unter der Regie von Thomas Birkmeir am Münchner Residenztheater begann damit, dass Judith, gespielt von Sophie von Kessel, mit Handschellen am Siphon eines Waschbeckens gekettet, sich in selbiges übergibt. Ein Siphon ist selbst für einen Laien keine wirkliche Fixierung. Egal. Um 22.30 Uhr am 24. Dezember, also am „Heilig Abend“, betritt der Polizist Thomas den Raum.
Für alle die meinen, es handele sich beim „Heilig Abend“ um einen vom Handel organisierten Jahresschlussverkauf, nein, es ist der vermeintliche Geburtstag, des vermeintlichen Heilands, dessen Existenz nie zweifelsfrei nachgewiesen wurde und der lediglich in einem Buch namens Bibel, dass in der heutigen Form erst dreihundert Jahre nach dessen vermeintlicher Geburt auf Befehl eines römischen Kaisers namens Konstantin in Auftrag gegeben wurde, entstand. Konstantin hatte, vielleicht unter Einfluss von psychedelischen Drogen, vor einer Schlacht im Jahr 312 eine Kreuzerscheinung am Himmel. Das Christentum wurde Staatsreligion, eines der besten Geschäftsmodelle in der Geschichte. Zu Luthers Zeiten, wir feierten den „Ketzer“ gerade aufwendig, gehörten der katholischen Kirche ein Drittel des deutschen Grundbesitzes. Warum die epische Breite, wird sich nun mancher fragen? Weil der „Heilig Abend“ eine plumpe Lüge ist, die vormals als blanke Wahrheit verkauft und inzwischen mit Symbolkraft aufgeladen wurde, weil die historischen Lügen keinen Bestand mehr hatten. Ist es nun ein oberflächlicher Effekt von Daniel Kehlmann, sein Stück „Heilig Abend“ zu nennen, oder glaubt er ernstlich, dass die Suggestion, an diesem Abend finde tatsächlich eine besondere Besinnung auf (das Thema) Frieden statt, verfängt? Egal.
Judith, Philosophieprofessorin, ist von der Polizei aus dem Taxi heraus „zu einer Befragung gebeten worden“. Dann hing sie am Siphon. Ein wesentlicher Faktor des Stücks ist die Zeit. Untertitel: Ein Stück für zwei Schauspieler und eine Uhr. Kehlmann setzte in diesem Stück eine Faszination um, die durch den Film „High Noon“ bei ihm ausgelöst wurde. (Regie: Fred Zinnemann, 1952) Darin muss sich ein Sheriff gegen die Zeit auf ein tödliches Duell mit mehreren Bösewichtern rüsten, deren Anführer 12.00 Uhr mittags mit dem Zug ankommt, Handlung in Echtzeit also. Polizist Thomas, eher schlicht gestrickt und mit einer gehörigen Portion aggressiver Blockwartsmentalität ausgestattet, hat bis Mitternacht ganze 90 Minuten Zeit. Wofür? Nun das erfährt man erst nach 30 Minuten. Thomas vermutet, dass Judith und ihr Ex-Mann eine Bombe deponiert haben, um „zur Destabilisierung des Status Quo“ beizutragen.
Die Bombe soll um Mitternacht zur Explosion gebracht werden. Wo ist die Bombe? Immerhin, dreißig Minuten lässt sich Thomas Zeit mit Smalltalk über sich, sein Leben, die Welt und über die Tatsachen, dass nichts, aber auch gar nichts aus dem Leben der Professorin Judith mit gutbürgerlichem Hintergrund und ihrem Ex dem Gesetzeshüter verborgen blieb. Hier hatte sich Daniel Kehlmann von den Aussagen Edward Snowdens, dem letzten echten Helden Amerikas, inspirieren lassen. Illegale revolutionäre Aktivitäten in Lateinamerika wurden ebenso ans Licht der staatlichen Redlichkeit gezerrt wie intimste Geschichten aus der gescheiterten Ehe und dem Leben des Ex-Manns, der, was für eine Überraschung, schon seit 24 Stunden im Nebenraum verhört wurde.
| |
 |
|
| |
Sophie von Kessel (Judith), Michele Cuciuffo (Thomas)
© Thomas Aurin
|
|
Darauf kam man nicht zwangsläufig, denn das Bühnenbild von Andreas Lungenschmid ließ gleichsam die Vermutung zu, man befinde sich in einem stillgelegten Kaufhaus, in dem gerade renoviert wird. Große gläserne Trennwände mit teilweise zerrissener Folie abgeklebt, ließen immerhin so viel Durchblick zu, dass dahinter zwei große Trittleitern auszumachen waren. Es stellte sich spontan die Frage, in welchem Land befindet man sich eigentlich, wo Polizeistationen, Repräsentationsgebäude der staatlichen Exekutive so aussehen? Diese Frage wurde noch quälender, als Thomas Judith mit extremer Gewalt zwei Faustschläge in den Unterleib verabreichte. (In Deutschland verlor ein hochrangiger Ermittler im Entführungsfall des Frankfurter Bankierssohns Jakob von Metzler seinen Job, weil er, um das Leben des Kindes zu retten, dem Mörder Gewalt lediglich angedroht hatte.) Egal.
Nehmen wir einmal an, es handele sich bei dieser Fiktion um so etwas wie einen Versuchsaufbau, um unter Laborbedingung zu brauchbaren, auf die Gesellschaft übertragbare Wahrheiten zu kommen. Judith wählte genau diese Ausrede, als man sie mit einem Pamphlet konfrontierte, das auf ihrem Rechner „versteckt“ war: „Wir bekennen uns zu dieser Aktion, gesetzt zur Mitternacht des vierundzwanzigsten Dezember.“ Es handelte sich nur um ein hypothetisches Theorem, wie Judith zu erklären versuchte, als Basis für ein Seminar, Gedankenspiele, wissenschaftliche Arbeit. Im Stück ging es nun darum, die Frage zu beantworten, ob die Sicherheit in der Gesellschaft gegen Freiheit eingetauscht werden darf. Kehlmann selbst formuliert es in Bezug auf das unbedingte Recht der beiden Protagonisten in einem dramatischen Werk wie folgt: „Ist die Sicherheit der Bürger es wert, die Freiheit zu opfern? Oder ist Freiheit das höchste Gut, das niemals, keinen Schritt weit, preisgegeben werden darf? Die Antwort auf beide Fragen ist natürlich ein klares Ja.“
Hier ist Widerspruch angebracht, denn die erste Frage resultiert aus der gesellschaftlichen Praxis, ein Totschlagargument von Innenminister, Konservativen und „besorgten Bürgern“, die zweite indes ist eine philosophische Frage, immer wieder beschworen von zumeist linken Idealisten, Ethikern oder Richtern des Verfassungsgerichts. In dieser Konstellation und in dieser Gegenüberstellung ist alles möglich, nur keine Wahrheitsfindung. Für einen Theaterabend mag das unterhaltsame Experiment taugen, für die Bewältigung der existenziellen Fragen dieser Welt nicht. Die Welt mag ungeheuer komplex sein und die Vielfalt der Anschauungen über die Welt ist es ebenso. Doch die Triebkräfte, die die Welt bewegen, sind beschämend simpel.
Am Ende aller Aufstände, aller Revolutionen, aller Revolten stehen doch immer wieder nur die Geldströme, allerdings in veränderten Flussbetten. Das ist der ganze banale Sinn von gesellschaftlichen Entwicklungen und die Ideen von der besseren Welt sind theatralische Intermezzi, die zwar unterhaltsam, jedoch der Realität nicht wirklich zuträglich sind. 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte, in der die heute lebende Menschheit vermutlich einmal von menschlicher Hand ausgerottet worden ist, haben dazu geführt, dass sich mehr als die Hälfte des Weltvermögens in der Hand von nur einem Prozent der Menschen befindet. Dass die Politik, wer mag die Krise der Parteienpolitik in Deutschland noch leugnen, dabei zum Hemmschuh geworden ist, will sie sich doch mit nachweislich vergeblichen Regulierungsmaßnahmen ihre Glaubhaftigkeit beim Wähler (Arbeitgeber) erhalten, beweist letztlich die Tatsache, dass die herrschende Klasse (die Besitzenden) die politischen Führer inzwischen selbst stellt, also Milliardäre (politische Blindgänger) Präsidentenämter bekleiden. Selbst im kommunistischen chinesischen Volkskongress ist die Zahl der Millionäre dreistellig und die der Milliardäre beachtlich. Das ist nur aufrichtig und ehrlich, wenngleich unappetitlich, denn wenn Konzernbosse zu Enddarmbewohner dieser politischen Knallchargen mutieren (Siehe unlängst in Davos!), ist der „Zoff“ gleichsam vorprogrammiert. In den letzten 55 Jahren des 20. Jahrhundert, also nach dem 2. Weltkrieg, fanden weltweit 218 Kriege, Bürgerkriege und militärische Konflikte statt. Soviel zur Lernfähigkeit und zum Friedenwillen des Menschen.
Judith hat es sinngemäß auf den Punkt gebracht, wenn sie meint: Fürchtet nicht die Handvoll Terroristen, sondern den Hunger weltweit. Die Leader dieser Welt (Sie vermeiden ganz bewusst das deutsche Wort.) nehmen diesen „Zoff“ gern in Kauf, denn hinter jedem Konflikt und dem Ruf nach innerer/äußerer (ist beliebig) Sicherheit steht ein Geschäftsmodell und wieder baden wir in den Strömen des Geldes. So schießen in Syrien Kurden, für die Türken sind sie Terroristen, für alle anderen Kurden Freiheitskämpfer, mit deutschen Panzerabwehrraketen auf deutsche Leopardpanzer, gesteuert von türkischen Armeeangehörigen, für die Türken sind sie Patrioten, für viele andere Schergen eines Diktators. Egal, wie der Konflikt ausgeht, ein Gewinner steht bereits fest. Bitte ein Tusch! The winner is: Die deutsche Wirtschaft. Schamgefühl? Egal.
Und noch ein desaströser Fauxpas durfte der Zuschauer an diesem Abend erleben, nämlich als Polizist Thomas seinen Halfter samt Waffe über jenen Stuhl hängte, auf dem Judith saß. So blöd kann doch kein Polizist sein, der seinen Beruf gelernt hat. Es haperte jedoch nicht nur an manchen szenischen Einfällen, sondern durchaus auch an der Anlage der Rollen. Während Michele Cuciuffo einen durchwegs glaubhaften und angesichts der intellektuellen Überlegenheit seiner Gegenspielerin trotzdem einen überaus witzigen Polizisten gab, dessen physische und sprachliche Präsenz die Inszenierung über weite Strecken allein trug, versetzte die Eintönigkeit Sophie von Kessels Judith einige Male in Erstaunen. Bei dieser Figur handelte es sich um eine hartgesottene Revoluzzerin, die nicht nur über Erfahrungen im Widerstand (Peru und Chile, wo man nicht zimperlich mit Systemkritikern umging) verfügte, sondern auch über die intellektuelle Überlegenheit dank eines Instrumentariums philosophischer Argumente. In der Werbung zum Stück wurde vorab ein Schlagabtausch beschworen, der Thomas, den Vertreter der systemischen Macht, in eben jene Enge treiben sollte, die ihm intellektuell eigen ist. Dem war keineswegs so. Vielmehr verkörperte Sophie von Kessel eine ängstliche und hysterische Frau, der weder ihre intellektuelle Fähigkeit noch ihr Wissen um revolutionäre und konspirative Methoden zu einer spielerischen Überlegenheit verhalfen. Wäre diese Überlegenheit sichtbar geworden, wäre wenigstens der plötzliche Gewaltausbruch des Staatsdieners glaubhaft(er) gewesen.
Das Stück steht auf schwankendem Boden und brachte eines mit Gewissheit nicht, einen Zuwachs an brauchbaren Einsichten. Es ist ein sprachlich ausgefeilter Betrag mit einigen verblüffenden Wendungen und einem Erinnern an Frantz Fanon zum Thema unserer Zeit. Terrorismus. Welchen Raum nimmt der Terrorismus real in unserer Gesellschaft ein? Einen kaum messbaren! Wenn Kehlmann von Gefangenschaft spricht, dann beschwört er eine Gefangenschaft, die bewusst und unbewusst von kleinen Teilen der Gesellschaft erzeugt wird und die nur in unseren Köpfen stattfindet. Es mag sich jeder selbst befragen, in wieweit er sich freiwillig in dieses Gefängnis begeben hat. Genau an diesem Punkt beginnt nämlich der Bürger seine Freiheit abzutreten. Egal? Aber gut, dass wir darüber geredet haben …
Wolf Banitzki
Heilig Abend
Ein Stück für zwei Schauspieler und eine Uhr
von Daniel Kehlmann
Sophie von Kessel und Michele Cuciuffo
Regie: Thomas Birkmeir
|
Residenztheater Alice im Wunderland von Lewis Caroll
Die Poesie des Nonsens
Alle Jahre wieder: Ein Weihnachtsmärchen für die Kleinen und die, die sich das Kleinsein erhalten konnten. Diesmal kam der bedeutendste Klassiker der Nonsens-Literatur auf die Bühne: Alice im Wunderland. Autor dieses wunderbaren, weltweit gelesenen Werkes war der Tutor für Mathematik Charles Lutwidge Dodgson, der sich den Künstlernamen Lewis Carroll gab. Er unternahm am 4. Juli 1862, der Termin ist umstritten, denn das Wetter war an diesem Tag scheußlich, mit den Töchtern des Oxforder Dekans, Lorina Charlotte, Alice Pleasance und Edith Mary Liddell eine Bootsfahrt auf der Themse. Dabei erzählte er ihnen eine sehr skurrile Geschichte, die er anfänglich „Alice’s Adventures Under Ground“ und dann später nach etlichen Hinzufügungen „Alice’s Adventures in Wonderland“ nannte. Auf den Tag genau drei Jahre später erschien die erste Buchausgabe.
Lewis Carroll hatte sich schwer getan mit einer Veröffentlichung, betrübte ihn doch die Unsicherheit, dass Kinder den Text nicht verstehen und ihn somit auch nicht rezipieren könnten. Zerstreut wurden die Bedenken durch den engen Freund George MacDonald, schottischer Dichter und Pfarrer, der den Text seinem Sohn Greville vorlas, der über alle Maßen begeistert reagierte. Gewidmet hatte Caroll das Buch über die Abenteuer der kleinen Alice, das von Königin Victoria ebenso begeistert gelesen wurde wie von Oscar Wilde, der gleichnamigen Alice Pleasance Liddell.
Leider scheint sich hinter der Beziehung zwischen Caroll und dem von ihm bevorzugten Mädchen und Fotomodell ein dunkles Geheimnis zu verbergen, denn die Freundschaft mit der Familie Liddell brach im Juni 1863 abrupt ab. Niemand erfuhr den Grund dafür und die Familie des Schriftstellers tilgte sämtliche Dokumente, die darüber hätten Aufschluss geben können. 1880 brach auch die Karriere als recht erfolgreicher Hobbyfotograf ab. Caroll bevorzugte als Modelle Mädchen im Alter von fünf oder sechs Jahren, die er auch nackt ablichtete. Die Malerin Emily Gertrude Thomson, die Caroll die jungen Modelle vermittelte, berichtete von den Fotosessions: „Wie sein Lachen klang – wie das eines Kindes!“ Hoffen wir mal, dass alles so unschuldig war, wie es sich in diesem Satz darstellt.
| |
 |
|
| |
Till Firit (Hutmacher), Barbara Melzl (Herzkönigin), Mara Widmann (Weißes Kaninchen), Arthur Klemt (Diedelidum), Arnulf Schumacher (Henker), Wolfram Rupperti (Diedelidei), Tim Werths (Mäusemann)
© Thomas Aurin
|
|
Zum Text: Alice ist ein vorlautes Geschöpf, dem Regeln eigentlich zuwider sind. Als sie gemeinsam mit ihrer Schwester in freier Natur weilt, die Schwester liest ein langweiliges Buch, in dem es weder „Bilder noch Gänsefüßchen“ gab, entschlummert sie in einen Traum. Ihr war ein weißes Kaninchen begegnet, dem sie in dessen Bau folgt. Alice gerät in eine wundersame Welt voller skurriler Figuren und Landschaften. Kaum etwas macht wirklich Sinn. Doch das war längst kein Grund für das Mädchen, zu verzweifeln. „(…) Alice hatte sich so sehr an das Außerordentliche gewöhnt, dass ihr die Normalität fade und dumm erschien.“ Die Reise führt sie zuallererst durch die Sprache, in der alles möglich scheint. Sie breitet sich ebenso widersinnig labyrinthisch aus, wie die seltsamen Charaktere und deren Größenverhältnisse. Alice kann sich in Sekundenschnelle von einer drei Meter großen Riesin auf das Format einer Raupe schrumpfen. Dabei gerät sie beispielsweise in ein Haus, das durch ihr Wachstum zu bersten droht, oder in einen See, der aus ihren eigenen Tränen besteht. Als sie am Ende einem für alle Beteiligten tödlich endenden Prozess der Roten Königen entkommt, deren Hofstaat sich als flatternde Spielkarten entpuppt, erwacht sie im Schoß der Schwester, die ihrerseits den Traum aufgreift und sich von der durch Alice angeregten Fantasie in den Sonnenuntergang tragen lässt.
Regisseurin Christina Rast hielt sich im Wesentlichen an die literarische Vorgabe und breitete die ganze Fülle der Szenen vor dem staunenden Publikum im Residenztheater aus. Dabei hatte sie einige physikalische Hürden zu überwinden, z.B. das permanente Schrumpfen und Wachsen. Immerhin konnte sie auf einige Erklärungen im Text zurückgreifen, denn schließlich ist ja alles relativ. War die Tür klein, war Alice, gespielt von einer quietschlebendigen Anna Graenzer, groß, und umgekehrt. Fraglich blieb allerdings, ob die kleinsten Besucher, die Vorstellung war für Kinder ab 6 Jahre ausgeschrieben, das auch erfasst und verstanden haben. Egal, es war allemal Spektakel genug auf der Bühne, um die Kleinen wie die Großen zu fesseln.
Dafür sorgten auch die exzellent kostümierten Figuren (Kostüme Marysol del Castillo) wie das Weiße Kaninchen, perfekt mit Mara Widmann vom Münchner Volkstheater besetzt, oder der Hutmacher, beeindruckend präsent und sprachlich geschliffen von Till Firit gestaltet. Eine Anleihe aus „Alice im Spiegelland“ waren Arthur Klemt als Diedelidum und Wolfram Rupperti als Diedelidei. Das spiegelverkehrte Paar (die Zwillinge Tweedledee und Tweedledum) sorgte ebenso für Amüsement wie Tim Werths Humpdipumpel, gleichsam aus dem „Spiegelland“ entlehnt, wo er ein „Ei auf der Mauer“, genannt Humpty Dumpty, gab. Im Residenztheater schwebte er federleicht in den Höhen des (Bühnen-) Himmels, quasi von oben herab seine krude Weltsicht propagierend. Ihm verdankt die Welt immerhin den „Ungeburtstag“, den man an 364 Tagen im Jahr feiern kann. Arnulf Schumacher, dem Residenztheatergänger seit vielen Jahren hinreichend bekannt, war eigentlich nur als Henker erkennbar, dabei belustigte er darüber hinaus als Walross, Absolem – die Raupe und als Babyferkel.
Beängstigend wuchtig geriet Barbara Melzls Herzkönigin, besonders wenn sie nachdrücklich „Kopf abschlagen!“ forderte. Das verbreitete bei den Kleinen im Publikum doch einigen Schrecken, zumal wenn, wie im Text, diese Forderung nicht deutlich zurückgenommen wurde. Dort nämlich verkündete beispielsweise der Herzkönig, in der Spielfassung ein (sinnvolles) Opfer des dramaturgischen Strichs, im Abgang die Begnadigung aller Verurteilten. Noch deutlicher wurde (im Text und nicht auf der Bühne) der Greif (Jabberwocky), der Alice zur Falschen Suppenschildkröte brachte, damit sie von der ihre traurige Lebensgeschichte erfahren sollte. Er stellte richtig: „Was für ein Spaß!“ Als Alice sich nach dem Spaß erkundigte, erklärte der Greif: „Nun, Sie natürlich. Das geschieht doch alles nur in Ihrer Einbildung: niemand denkt daran, jemanden hinzurichten.“
Die Grinsekatze, ihre Stimme aus dem Off lieh ihr Raphael Clamer, entsprach ziemlich genau der Originalillustration von Sir John Tenniel und schlich sich immer wieder als Videoprojektion ein. (Video Katja Moll) Auf diese Weise war es für jedermann schlüssig und verständlich, wie ein Grinsen ohne Katze zustande kommt.
Es war eine gelungene Inszenierung, der das fantasievolle, sowohl schöne wie auch zweckmäßige Bühnenbild von Franziska Rast ein eindrucksvolles Fundament bereitete. Die Umsetzungen der Widersinnigkeiten mögen vielleicht nicht allen Kindern aufgegangen sein, für die Erwachsenen, die ja, verglichen mit den Kindern nicht unbedingt mit Fantasie und Weisheit gesegnet sind, war es eine intellektuelle Herausforderung, womit ganz nebenbei der Beweis erbracht wurde, dass Theater bildet. Die Textbearbeitung von Christina Rast und Götz Leineweber erleichterten das Verständnis (soweit es darauf überhaupt ankam) durchaus. Die Lieder von Felix Müller-Wrobel, beherzt musikalisch untermalt von den Musikern Micha Acher, Cico Beck, Mathias Götz und Alex Haas, hatte eine ganz eigene Qualität, die den Vergleich zu Lewis Carolls Nonsens-Gedichten nicht scheuen brauchten.
Es ist vorstellbar, dass es nicht einfach sein wird, für diese Inszenierung Karten zu bekommen. Aus gutem Grund!
Wolf Banitzki
Alice im Wunderland
von Lewis Carroll
für die Bühne bearbeitet von Christina Rast und Götz Leineweber mit Liedern von Felix Müller-Wrobel
|
Anna Graenzer, Mara Widmann, Barbara Melzl, Till Firit, Tim Werths, Arthur Klemt, Wolfram Rupperti, Arnulf Schumacher,
Alexander Breiter, Claudia Ellert, Oliver Exner, Julien Feuillet, Kirsten Schneider, Monika Steinwidder, Olivia Szpetkowska, Dave Wickrematilleke
Live-Musiker: Micha Acher, Cico Beck, Mathias Götz, Alex Haas
Regie: Christina Rast
|