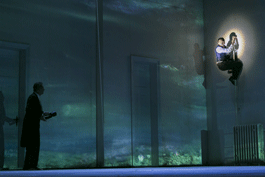Residenztheater Kinder der Sonne von Maxim Gorki
Der Schoß ist fruchtbar noch
"Kinder der Sonne", nicht nur metaphorisch, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes gemeint, das sind wir, wir alle. Der große Feuerball ermöglichte die Entstehung erster Eiweißmoleküle. Nach einigen Millionen Jahren waren daraus Frösche geworden und später auch Affen, deren Existenz schließlich in der evolutionären Krönung gipfelte, im Menschen. Also kann mit Fug und Recht behauptet werden, dass wir alle Kinder der Sonne, des Lichtes sind. Diese Vorstellung euphorisiert den Wissenschaftler Protassow geradezu, denn er sieht am Horizont schon die physische, psychische und moralische Vollkommenheit des Wesens Mensch, ein Wesen, dass eben diese Vollkommenheit erst in der Retorte erreicht. Einiger chemischer und physikalischer Erkenntnisse bedarf es zwar noch, doch das Ergebnis wird unbestritten grandios sein. Lästig allein sind die Banalitäten, die sich dem Fortschritt der Forschung immer wieder in den Weg stellen. Diese Banalitäten werden in ihrer Summe gemeinhin auch Leben genannt.
Protassow, ganz seinen hehren Zielen verschrieben, wird von seinem Vermieter Nasar Awdejewitsch wegen der ausstehenden Miete bedrängt. Dabei hatte er diesem sein Haus, für das er nun Miete zahlen muss, verkauft und erwartet Kulanz. Doch Nasar Awdejewitsch ist ein Mann des Geldes und darum wenig nachgiebig. Der genervte Protassow vernachlässigt zudem seine Gattin Jelena Nikolajewna, die sich ihrerseits mit dem Maler Dmitrij Sergejewitsch Wagin, einem Jugendfreund des Wissenschaftlers, erfolglos zu trösten versucht. Der Arzt Boris Nikolajewitsch Tschepurnoj ist Dauergast im Hause Protassow, denn er liebt dessen kränkelnde Schwester Lisa. Boris` Schwester, eine durch eine zweifelhafte Ehe mit einem vermögenden, aber ungeliebten Mann reich geworden, stellt Protassow indes mit allen erdenklichen Avancen, bis hin zur hemmungslosen Selbsterniedrigung, nach.
Diesem gutbürgerlichen Haushalt aus Abgehobenheit, Ignoranz der gesellschaftlichen Realitäten, persönlichen Kabalen und Sinnentleerung stehen zwei Figuren gegenüber, die zum Sinnbild der Krise werden, und hier darf man getrost von gesellschaftlicher Krise sprechen: Jegor, ein von Protassow für seine Arbeit immer wieder verpflichteter Schlosser, ein Trunkenbold, der unentwegt seine Ehefrau misshandelt, und Fima, das Dienstmädchen im Hause Protassow, die in permanenter Verhandlung steht, um sich so teuer wie möglich zu prostituieren. Im Hintergrund der Handlung grassiert eine Choleraepidemie, die für das Gären in der Gesellschaft steht und die für alle zu einer tödlichen Bedrohung wird. Das von Gorki 1905 in der Haft verfasste Drama kündet ein Wetterleuchten an, nämlich die Revolution von 1917. Inzwischen ist der Beweis erbracht, dass das Experiment einer gesellschaftlichen Umwälzung über eine Parteiendiktatur, hier die der Bolschewiki, gescheitert ist. Dennoch transportiert das Stück mehr, als eine bloße Beschreibung der Entstehung einer revolutionären Situation.
 |
||
|
Norman Hacker, Aurel Manthei, Hanna Scheibe © Thomas Dashuber |
David Bösch fand in seiner Lesart für die Bühne des Münchner Residenztheaters eine Menge Potential, um mit Gorkis Worten auch die heutige gesellschaftliche Situation zu charakterisieren. Norman Hackers Protassow war ein Mann mit großen Ideen und Idealen. Allein seine Realitätsfremdheit macht ihn zu einer komischen, aber beileibe nicht zu einer lächerlichen Figur, denn ohne Männer wie ihn, hätte es deutlich weniger Fortschritt gegeben. Er mag vielleicht ein hervorragender Wissenschaftler sein, seine Unfähigkeit, mit den Banalitäten und den alltäglichen Konflikten umzugehen, und die daraus resultierende Verzagtheit waren urkomisch. Hanna Scheibe als Ehefrau Jelena Nikolajewna erwachte aus der Egozentrik ihres weitestgehend sinnentleerten Daseins erst, als die Ehefrau des Schlossers Jegor lebensgefährlich erkrankt war. Ihr mutiges Engagement, mit dem sie sich durchaus selbst in Gefahr brachte, unterstrich diese Sinnentleerung. Dmitrij Sergejewitsch Wagin, ein blasierter Aurel Manthei im Blaumann und mit Melone, war keine Alternative für die liebes- und lebenshungrige Frau. Seine künstlerischen Visionen waren ebenso abgehoben wie die wissenschaftlichen Ideen Protassows.
Joachim Nimtzs Geschäftsmann Nasar Awdejewitsch agierte wie ein russischer Oligarch schlimmster Couleur, selbstbewusst-zielstrebig, unverbindlich und ergebnisorientiert. Und dieses Ergebnis war leicht in Zahlen zu übersetzen. Sein Sohn Mischa erschien, dargestellt von Max Koch, wie ein billiges Abziehbild. Diese schmierige Figur eines Kleinkriminellen, die sich selbst „Russian Tiger“, nannte, war immerhin sehr unterhaltsam, ebenso wie die verzweifelte Melanija, die mit allen Mitteln um die Gunst Protassows buhlte. Schon die Tatsache, dass diese Rolle mit Katharina Pichler, eine wahre Augenweide für jeden Mann, der noch ein wenig Leben in sich spürt, besetzt war, charakterisierte Protassow als sinnesfeindlichen und blinden Mann.
Lisa, der kränkelnden Schwester Protassows, verlieh Mathilde Bundschuh mit großer Eindringlichkeit kassandraische Züge. Wie ihre antike Vorgängerin wurde auch sie erst zu spät erhört. Grandios gab Till Firit den Arzt Boris Nikolajewitsch Tschepurnoj. Mit leicht hysterischen Untertönen versank er im Strudel seiner Leidenschaften für Lisa, die gleichsam zu spät kam mit ihrer Entscheidung, Boris zu lieben. Er hätte ihr wohl geben können, wonach sie sich sehnte.
Und so nahm die Katastrophe ihren Lauf. Den Höhepunkt erreichte sie, als Schlosser Jegor, martialisch und aggressiv von Thomas Huber gespielt, in die bürgerliche Welt einbrach, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. Wofür? Erst einmal wohl für sein eigenes verkorkstes Leben. Und da man damit keinen Staat machen kann, schrieben er und seine Spießgesellen die Rache am Betrug des Staates und der Vermögenden auf ihre Fahnen. Die Behauptung, dass die Cholera eine Erfindung der Apotheker sei, um das arme Volk noch mehr auszuplündern, versetzte sie in Raserei, dem die ohnehin nicht sonderlich attraktive, schmuddelige und abgewohnte Behausung (Bühne: Patrick Bannwart) Protassows zum Opfer fiel. Und genau an diesem Punkt war das Theater endgültig in der Realität angekommen. Wutbürger tobten sich hemmungslos aus, schlugen alles kurz und klein und brüllten dabei absurde Parolen – so genannte alternative Wahrheiten. David Bösch pfiff auf politische Korrektheit, und nannte die Dinge beim Namen. Pöbel war Pöbel, Gesindel war Gesindel, Mob war Mob. Was niemand für möglich gehalten hatte, war plötzlich Realität, und nicht nur auf der Bühne, denn nur ein paar Stunden später zogen die Vertreter des Pöbel, des Gesindel, des Mobs in das deutsche Parlament ein. (Gut nur, dass David Bösch keine Wahlen gewinnen muss!)
Um an dieser Stelle nicht in Hysterie zu verfallen: Mit diesen „ideologischen Schmuddelkindern“ wird die deutsche Demokratie fertig werden. Doch die „gutbürgerliche Schicht“ im Land muss sich eingestehen, dass sie Protassow nicht unähnlich war und ist. Wenn die Ideale, gleichsam eine strahlende Sonne, nur hoch genug gehalten werden, wird ihr Licht jeden Winkel der Vernunft ausleuchten. Nein, das wird sie nicht und wir sind darum auch keine „Kinder der Sonne“. Wir haben, stets die höchsten Ideale im Blick, die vergessen und aus dem Blick verloren, die sich diese Ideale schlichtweg nicht leisten können, die, die in anderen ökonomischen Verhältnissen leben als die lächerlichen Hochglanzfiguren der Werbung, die, die Angst haben, weil man ihnen nicht glaubhaft vermitteln konnte, dass Menschlichkeit, und nichts anderes war die Aufnahme der Flüchtlinge, diese Gesellschaft ökonomisch keineswegs in eine Schieflage bringt. Der Reichtum dieser Gesellschaft ist ein abstrakter Begriff geworden, denn der Reichtum wird nicht auf vernünftige Weise gelebt oder praktiziert. Er wird allzu oft mit dem perversen Luxus, den einige wenige in diesem Land leben, verwechselt. Und im Schatten dieses falschen Glanzes entwickelt sich der Mensch vom zivilisatorischen Wesen zurück zur Bestie, die man überwunden glaubte. Es findet sich noch immer jemand, der diese Entwicklung befeuert, weil fruchtbar noch der Schoß ist …
Und war das nicht zu erwarten? Wenn eine neoliberale Welt alles daran setzt, um aus gebildeten, mündigen Bürgern verblödete Konsumenten zu machen, ist die Barbarei des Geistes und auch des realen Umgangs miteinander vorprogrammiert. Das, und vieles andere mehr waren aus der gelungenen Inszenierung David Böschs herauszulesen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht hat das Theater ja ein paar brauchbare Ideen. Die Politik und unser bürgerliches Selbstverständnis sind da eher ratlos.
Wolf Banitzki
Kinder der Sonne
von Maxim Gorki
Deutsch von Ulrike Zemme
| Norman Hacker, Mathilde Bundschuh, Hanna Scheibe, Aurel Manthei, Till Firit, Katharina Pichler, Joachim Nimtz, Max Koch, Thomas Huber, Pauline Fusban Regie David Bösch |