Teamtheater Tankstelle Moby Dick nach dem Roman von Herman Melville
Von Tyrannei und Vernichtung
Ismael ist ein Abenteurer. Wann immer ihm das Leben auf dem Land den Atem nimmt, schnürt er sein Bündel. „Mit philosophischer Geste stürzt Cato sich in sein Schwert. Ich begebe mich einfach an Bord. (…) Das ist mein Ersatz für Pistole und Kugel.“ Mit wenig, sehr wenig Geld machte sich Ismael auf den Weg nach Nantucket, wo er die erste Nacht sein Bett mit einem riesenhaften Mann teilen muss, der fraglos ein Kannibale ist und der in der Stadt Schrumpfköpfe verkauft. Der Hüne ist Fidschi-Insulaner, Harpunier und heißt Queequeg. Beide freunden sich schnell an und finden zusammen Heuer auf der „Pequod“, einem alten Walfänger. Es ist nicht einfach nur ein Roman, den Hermann Melville auf fast 700 Seiten erzählte, sondern es ist auch eine Dokumentation, gespickt mit enzyklopädischem Wissen seiner Zeit.
Die Einheimischen, Siedler und Indianer, von Nantucket begannen bereits um 1610 mit Walfang in den küstennahen Gewässern. 1830 war der Ort die „Welthauptstadt“ des Walfangs. Dann erlebte er einen rasanten Niedergang, denn die Entdeckung des Erdöls 1859 machte den Waltran, gewonnen aus dem Walspeck, als Lampenöl zunehmend überflüssiger. Dennoch fand der Walfang im industriellen Umfang erst 1984 mit einem allgemeinen Verbot ein Ende. Grund für die dauerhafte Jagd und Ausbeutung der Meeressäuger war das Spermaceti. Irrigerweise glaubte man, es handele sich um das Sperma des Pottwals, er war jedoch ein Mischöl, das aus einem über dem Oberkiefer liegenden Organ zur Echolotung gewonnen wurde. Bei einem 15 Meter großen Pottwal konnte man ca. 3000 Liter Walratöl, wie man das Endprodukt nannte, gewinnen. Ein ausgewachsener Pottwal wog ca. 50 Tonnen. Soweit ein paar Anmerkungen, um den perversen Charakter dieser Tötungen (1964 waren es mehr als 29.000 Tiere) zu verdeutlichen. Die Tiere wurden wegen einem Sechszehntel ihrer Körpermasse getötet.
Melvilles Roman „Moby Dick“, erschienen 1851, lässt diese Tatsachen nicht unerwähnt. Insofern war es auch ein Buch, das sich mit dem Abschlachten einer ganzen Spezies durchaus kritisch auseinandersetzte. Doch im Kern des Werkes ging es um einen Menschen, Kapitän Ahab, der bei Melville erst im 28. Kapitel, nach ca. 160 Seiten die Szene betritt. „Er sah aus wie einer, der vom Scheiterhaufen heruntergeholt wurde, nachdem das Feuer alle Glieder ergriffen hatte, ohne sie indes zu verzehren oder in ihrer festen bejahrten Rüstigkeit zu beeinträchtigen. Seine hohe breite Gestalt schien aus Bronze und wie Cellinis Perseus in eine unwandelbare Form gegossen zu sein.“ Eine bläuliche gertengleiche Narbe durchzog Ahabs Antlitz und es fehlte ihm ein Bein. Doch so ungeheuerlich sein Äußeres auf Ismael wirkte, es war nichts im Vergleich mit seinem Geist. Der war von Rache beseelt, von Rache gegen einen weißen Wal, dem er die Verunstaltung und das fehlende Bein verdankte: Moby Dick. Bald schon muss die Besatzung erkennen, dass Ahab nicht mehr im Dienst der Schiffseigner um den Profit bemüht ist, sondern seiner eigenen Obsession verfallen ist, die ihn rund um den Globus treibt. Mit ihm ein Haufen hervorragender Seemänner, die er immer wieder für seine Ziele begeistern und befeuern kann, denen er aber auch die starrsinnige Stirn bietet und Angst verbreitet, wenn sie dagegen aufbegehren. Das Ende ist hinlänglich bekannt. Ahab stirbt vom Hanf seiner Harpune an den weißen Wal gefesselt einen nassen Tod und die „Pequod“ sinkt zertrümmert in den Fluten.
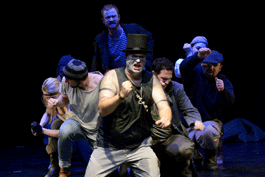 |
||
|
Ensemble |
Regisseur Andreas Wiedermann hat diese überbordende Geschichte vom fanatischen Ritt über die Weltmeere auf die räumlich sehr begrenzte Bühne des Teamtheaters gebracht. Es brauchte nicht mehr als zwei von der Decke herab hängende Wanten und ein paar Holzfässer, um die Illusion vom Schiffsdeck eines Walfängers zu erzeugen. Das Spiel begann im Zuschauerraum mit der Aufzählung mehr oder weniger gelungener Darstellungen von Walen in Wissenschaft und Kunst (Kapitel 55-57). Am Ende stand ein müdes Lächeln der Schauspieler, denn wenn überhaupt jemand etwas über Wale weiß, dann die Männer, die sie auf ihren bis zu vier Jahre dauernden Fahrten jagten, er- und zerlegten. Also ging es an Bord und auf die Reise.
Das junge Ensemble des Theaters IMPULS spielte, wie man es aus etlichen Produktionen Wiedermanns inzwischen kennt, sehr körperbetont. Die annähernd zwei Stunden wurden von dem Percussionisten Antonino Secchia akustisch und lautmalerisch begleitet und durchrhythmisiert. Dabei wurden Vorgänge bildlich durch das Stellen der Fässer konkretisiert, mal waren es Sitzmöbel, mal nur gestapelte Tranfässer, mal waren es die Ruderbänke der Beiboote, mit denen die Wale gejagt wurden oder Masthalterungen. Die Illusion funktionierte und verfing. Es braucht nur wenige Minuten, um den Wellengang zu erfahren. Der vielleicht beste Einfall der Inszenierung war es, Kapitän Ahab selbst nicht auftreten zu lassen. Die donnernde Stimme Frank Manholds erklang aus dem Off. Somit mussten der Schauspieler und auch der Regisseur die Überfigur dieses besessenen Kapitäns nicht auf der Bühne behaupten.
Physisch wäre das ohnehin nicht leicht gewesen, das Ensemble zu überragen, denn allein Clemens Nicols erster Harpunier Queequeg, ohne Frage eine ideale Besetzung, hätte das kaum zugelassen. Aber auch David Thuns erster Steuermann Starbuck, der einzige wirkliche Widerpart Ahabs ließ keinen Zweifel an seiner Mannhaftigkeit aufkommen. Selbst Christina Matschoss bestand als handfester zweiter Steuermann Stubb. Abgesehen von Clemens Nicols, dessen beeindruckende Körpermaße naturgemäß kaum ein totales Aufgehen im Ensemblespiel zulässt, behauptete jeder Darsteller seine Rolle souverän und integrativ. Harte Arbeit war es allemal, denn Wiedermanns Erzählung handelte von einer unbarmherzigen Waljagd. Das war kein Kindergeburtstag auf dem Ponyhof. Die Düsternis der Vorgänge wurde durch die Szenenwechsel noch eindrucksvoll verstärkt, in denen der Bariton Martin Ulrich zur minimalistischen Begleitung Antonino Secchias' Lieder von Franz Schubert sang.
Eine Stärke der Inszenierung lag auch in der Auswahl der Perspektiven und der Handlungen, von denen im Buch genug zu finden wären, um ein gutes Dutzend differierender Lesarten auf die Bühne zu bringen. Ein Fokus zielte auf die Barbarei des „Geschäfts“, zu der der Mensch auch heute noch fähig ist, wenn die Jagd detailliert geschildert wird. Es wurde beschrieben, welche Taktiken angewandt werden, wenn man auf eine ganze Schule von Walen trifft und so viele Tiere wie nur möglich töten will. Man macht beispielweise Kühe schwimmunfähig, deren Nachwuchs noch an der Nabelschnur hängt und so nicht auskann. Oder man durchtrennt den großen Tieren die Schwanzsehnen, quasi die Achillessehnen, so dass sie nicht mehr abtauchen können. Den Darstellern gelangt es durchaus, den Zuschauern diese barbarischen Bilder einzupflanzen.
Darüber hinaus gelang es Andreas Wiedermann, in der Figur des (nicht sichtbaren) Ahabs den Prototypen eines Tyrannen zu schaffen, der in der heutigen Welt eine Vielzahl von Entsprechungen findet. Er verhinderte damit die gemeinhin verbreitete Ansicht, dass Moby Dick mehr als ein Wal ist, nämlich Ahabs Schicksal. Dieser Symbolismus lenkt ab von den wahren Tatsachen. Hier geht es um einen gestörten Geist, der Tyrannei gebiert. Tyrannei ist in der Weltpolitik längst wieder angekommen und man steht vor diesem Phänomen einigermaßen fassungslos, weil man glaubte, dieser Typus gehöre längst der Historie an. Es ist also eine durchaus heutige Geschichte von Tyrannei und Vernichtung, die uns mit der mehr als 150 Jahre alten Erzählung aus der Feder Melvilles vermittelt wird. Die Inszenierung im Teamtheater war eine gute und verständliche Übersetzung dessen.
Wolf Banitzki
Moby Dick
nach dem Roman von Herman Melville
|
Simon Brüker, Constanze Fennel, Conny Krause, Matthias Lettner, Frank Manhold, Christina Matschoss, Clemens Nicol, Andreas Niedermeier, Martin Ulrich, David Thun Live-Musik Antonino Secchias / Bariton Martin Ulrich Regie Andreas Wiedermann |



