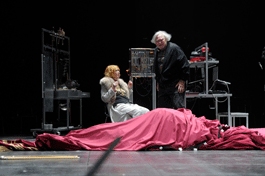Kammerspiele Miranda Julys Der erste fiese Typ nach dem Roman von Miranda July
Helden der Neuzeit
Cheryl Glickman ist 43 Jahre alt, alleinstehend und kinderlos. Diese, heutigentags nicht gerade seltene Konstellation gebiert Wesen, die anstelle von Leidenschaften eher Macken haben, die nicht lieben, sondern vor ihren Ängsten fliehen und die so sozial wie ein ausgestopfter Igel sind. Cheryl leidet an einer psychosomatischen Krankheit, einem nichtexistenten Kloß im Hals (Globussyndrom), der mittels Chromotherapie (in ihrem Fall mit Rot) einigermaßen erfolglos behandelt wird. Sie spricht, wann immer sich die Gelegenheit bietet, mit Kindern, die nicht ihre sind, die bei ihr allerdings mit Sicherheit besser aufgehoben wären. Und sie benutzt so wenig Geschirr wie nur möglich, weil schmutziges Geschirr der Anfang der völligen Verwahrlosung ist. Als Clee, die Tochter ihres Chefs „vorübergehend“ bei ihr einzieht, ist Cheryls ritualisierte Welt perdu.
Chaotisch war diese Welt schon vor dem Eindringen Clees. Mehr Kontrolle erlangte Cheryl auch bei gesteigerter Anstrengung nicht. Das lag aber nicht unbedingt an ihr, denn die trabentenhaften Figuren im großen Spiel des Lebens waren nicht weniger seltsam. Da kreiste neben ihrem Chromotherapeuten auch ein Kollege, er gehörte zum Vorstand der Firma, in der sie arbeitete, um dessen Liebe sie buhlte. Beim ersten Date gestand der ihr sein großes (schlimmes) Geheimnis. Er begehrte eine 16jährige und erbat von Cheryl ihren Segen, dass er sie deflorieren dürfe. Die Defloration zieht sich hin und der Zuschauer kann den Prozess mittels Kurznachrichten mit verfolgen. Dann kam die Schwangerschaft, nein, nicht die der 16jährigen, sondern Clees, und damit wurde es ernst im Leben der beiden Frauen. Über rabiate körperliche Auseinandersetzungen, (minutenlange Raufereien auf der Bühne), fanden sich die beiden miteinander in einer lesbischen Beziehung wieder. Doch auch die zerbrach und irgendwann zeichnete sich ab, dass Cheryl die Verantwortung für ein Kind übernehmen würde. Ihr Resümee der ganzen Geschichte ist der eigentliche Plot und soll nicht verraten werden.
Das Bühnenbild von Jonathan Mertz gab nicht vor, den Lebensraum der beiden Frauen zu beschreiben. Es war eine ausladende Spiel-Fläche, auf der in praktischen Holzboxen die Requisiten verwahrt waren. Darauf tobte das Leben, wie es von Clee, wenn sie einmal nicht gerade chillte, Chips aß, Cola trank und Geschirr schmutzig machte, befeuert wurde und in dessen Sog Cheryl wie ein trunkener Kreisel zum Taumeln gebracht wurde. Rüpings Raumaufteilung war schlicht und praktisch, hinten Mitterechts die Musikanlage, davor ausladend die Spielfläche leicht abgeschrägt zur Rampe hin. Aufgeteilt wurde der Bühnenraum durch drei Staffeln Gazeprospekte, auf die Videobilder gebeamt wurden.
| |
 |
|
| |
Anna Drexler, Maja Beckmann
© David Baltzer
|
|
Das Publikum wurde mit offenem Vorhang empfangen. Maja Beckmann und Anna Drexler absolvierten mit einigem physischen Einsatz ein scheinbar plan- und zielloses Fitnesstraining. Als das Licht im Zuschauerraum gedimmt wurde, wandten sich die beiden ans Publikum. Das wurde sogleich durch die direkte Ansprache vereinnahmt. Man signalisierte, dass es keine vierte Wand geben werde. Tatsächlich wurde das Publikum einbezogen und „mitverwertet“ (Brecht). Klar war von Anfang an, dass kein ästhetisch durchgestaltetes Werk zu erwarten war. Das Publikum nahm das dankbar an. Im Hintergrund, anfangs dezent, und mit fortschreitendem Spiel immer dominanter, begleitete kommentierend die Sängerin Brandy Butler mit ihrer wunderbaren schwarzen Blues- und Jazzstimme.
Die Videokünstlerin Rebecca Meining beleuchtete das Spiel mit ihrer Handkamera und erlaubte durch die vergrößernde Projektion sehr intime Ansichten der wunderbar beseelten Gesichter der Darstellerinnen. Beide spielten, als gäbe es kein Morgen mehr: entfesselt, uneitel und überbordend. Zwei große Talente gab es an diesem Abend zu entdecken, die allerdings noch ein wenig ungeschliffen daher kamen. Aber Mäßigung und Kontrolle zugunsten einer ausgefeilten Ästhetik ist nicht in der Programmatik der (neuen) Kammerspiele niedergeschrieben. Der Abend war Dank der Leistung der beiden Darstellerinnen kurzweilig, denn sie trieben nach bestem Wissen und Gewissen Schauspielkunst. Es gab nur wenige Momente, in denen sie ins Private abglitten oder in denen sie bewusst gegen ihre Rollen anspielten. Sie fügten sich ihnen weitestgehend.
Christopher Rüping und seine Crew durften sich glücklich schätzen, denn ihnen wurde von der Autorin Miranda July, „Sprachrohr moderner Großstadtbewohnerinnen“, explizit die Erlaubnis zur Dramatisierung erteilt. Dem Erstlingsroman wurde bei Erscheinen 2015 höchstes Lob zuteil. „The Guardian“ reihte ihn neben Tolstois „Anna Karenina“ in die Liga der zehn eindringlichsten Liebesromane ein. Miranda July trat zu Beginn ihrer künstlerischen Karriere als Performerin in Erscheinung. Performances haben immer einen zeitlich punktuellen Anspruch. Das macht ihre Einmaligkeit und ihre Vergänglichkeit gleichermaßen aus. Sie provozieren Emotionen und eröffnen Einsichten; sie taugen allerdings kaum für eine ethische oder philosophische Nachhaltigkeit, die man einem Tolstoi indes nicht absprechen kann. Und so mutet „Miranda Julys Der erste fiese Typ“ gleichfalls performativ an.
Ohne Zweifel ist Miranda Julys Roman ein originelles Werk, das Zeitgeist widerspiegelt und skurrile, absurde, kontraproduktive (neu sind sie gewiss nicht) Formen urbanen Lebens spiegelt. Doch den Roman auf eine Stufe mit Tolstois Werk zu stellen ist einigermaßen vermessen, denn es geht vornehmlich um Oberflächlichkeiten, um lust- oder leidvolle aber dennoch rationale Organisationsformen des Lebens. Zudem schwingt immer eine gewisse Infantilität im Umgang mit den Menschen, den Dingen und der Liebe mit. So verwundert es nicht, dass letztlich die Mutterschaft, der frühe, kitschige Traum jedes Mädchens, die Erlösung zu bringen scheint. Sie wurde zum Silberstreif am Horizont. Sie steht allerdings nicht für fleischgewordene Liebe oder das Verschmelzen von Menschen miteinander. Die bleiben isoliert, einsam und getrieben von Neurosen und Ängsten. Emanzipatorische oder politische Kategorien finden nicht statt. Die Botschaft, so eine beabsichtigt war: Das Leben ist furchtbar öde und trist und rauschhaft schön zugleich und irgendwie nehmen wir es auf fatalistische Weise an. Wer sein Leben zu gestalten sucht, versucht es auf seltsam schräge Art, Scheitern inbegriffen.
Wolf Banitzki
Miranda Julys Der erste fiese Typ
nach dem Roman von Miranda July
Maja Beckmann, Anna Drexler, Brandy Butler, Rebecca Meining
Regie: Christopher Rüping
Kammerspiele Der Kirschgarten von Anton Tschechow
Irgendwas stimmte nicht
Die Zeiten sind vorbei, in denen man einfach ins Theater ging, eine Geschichte, mehr oder weniger gut von den Schauspielern gestaltet oder vom Regisseur in Szene gesetzt, erlebte und Bilder voller Botschaften mit nach Hause nahm, die sich nachhaltig eingeprägten oder auch nicht. Theater hatte aufklärerischen und gelegentlich auch belehrenden Charakter. Dieser Ansatz ist heute weitestgehend der Lächerlichkeit preisgegeben, oder besser, der Zuschauer, der mit diesen oder ähnlichen Erwartungen ins Theater kommt. Er wird als ewiger Spießer ausgemacht. Dabei ist es nichts neues, dass Theater streitbar und auch umstritten ist. Das gibt es seit Aischylos, also seit zweieinhalbtausend Jahren. Neu ist das Maß der intellektuellen Verstiegenheit, mit dem sich Theater heute gelegentlich gibt. Nichts gegen eine Überforderung des Zuschauers, könnte der doch an dieser Herausforderung wachsen. Aber wenn Theater vornehmlich Diskurs ist, in dem sich „alternative Wahrheiten“ gegenüberstehen, denen wir allesamt in Podiumsdiskussionen, Talkshows und Kolloquien, inzwischen alles theatrale Ereignisse (!), respektvoll huldigen, dann läuft etwas grundverkehrt.
Wenn Theater eine moralische Anstalt ist, werden Werte vermittelt, die als Orientierungshilfe dienen können; wenn aber „neue Begriffe“ gefordert werden, „um mit dieser Realität klar zu kommen“, befördert das nicht die Erkenntnis, sondern die babylonische Sprachverwirrung. (Sprache ist Ausdruck des Geistes. Novalis.) Vielleicht sollte man einmal darüber nachdenken, warum Populisten momentan so erfolgreich sind? Gewiss nicht, weil sie neue Begriffe gefunden haben, um mit den Realitäten klar zu kommen, sondern weil sie über ein altes, sehr wirkungsvolles Sprachinstrumentarium verfügen, das sich schon in einigen Diktaturen bewährt hat. Es gab zu allen Zeiten auch ein Sprachinstrumentarium, nicht weniger wirkungsvoll, das positive Entwicklungen befördert hat und Anfängen wehren konnte, welches wir aber scheinbar vergessen haben. Statt den Populisten um die Ohren zu hauen, dass ihre „alternativen Wahrheiten“ Lügen sind, dass ihre Hetze gegen Fremde übelster Rassismus und strafrechtlich relevant ist, dass die Aufwiegelung der Bürger gegen die demokratische Ordnung grundgesetzwidrig ist und ebenso bestraft werden müsste, holen wir die unterbelichteten, faschistoiden Gesellen in die „Theater“ dieser Gesellschaft und geben ihnen das Wort. Soviel ist mal sicher, eine Demokratie, die nicht wehrhaft ist, ist wert, dass sie zugrunde geht. Aber egal, Hauptsache, der Untergang ist unterhaltsam und wir amüsieren uns dabei prächtig. Theater sollte diesen Untergang nicht begleiten, sondern endlich mal kämpferisch werden. Es geht auch um die Existenz von Theater, wenn die Kulturprogramme der AfDler ins Grundgesetz aufgenommen werden. Dabei geht es nicht darum, die alte Ordnung, die ins Wanken geraten ist, zu restaurieren, sondern eine neue zu gestalten, in denen kein Raum für diesen Kleingeist ist, der unter dem Teppich der Geschichte hervorkriecht. Aber vermutlich wird sich so eine neue Ordnung nicht rechnen und ein Börsengang ist auch nicht möglich.
Warum dieser lästige und wohl auch überflüssige Exkurs, der in einer Theaterkritik eigentlich nichts zu suchen hat? Weil das Theater eine Heimstatt des Wortes ist! Weil nirgendwo sonst das Wort eine so starke Wirkung erzeugt. Denn es wird von Menschen, die es gelernt haben, das Wort wirkungsvoll zu artikulieren, und von Menschen, die diese Menschen wiederum wirkungsvoll in Szene setzen können, gemacht. Nun ist im Programm zu lesen, dass Nicolas Stemann bislang ausschließlich „postdramatische Textflächen“ bearbeitet und „postheroische Klassikerlesarten“ entwickelt hat. Diese Begriffe erklären sich vielleicht ein Stück weit durch Stemanns Inszenierungsansatz von „Kirschgarten“: „Es steht alles im Stück, man muss es nur machen. Ein Stück, in dem Menschen sagen ‚Ich gehe durch eine Tür.‘ und ich als Regisseur muss mich nur darum kümmern, wie sie durch die Tür gehen, warum, und wie es ihnen dabei geht – muss aber nicht immer entscheiden, wer spielt das jetzt, und wenn ja, wie viele (postheroisch – Anm. W.B.), wird es chorisch skandiert oder solistisch gesungen – (postdramatisch – Anm. W.B.) – nein: es geht einfach ein Mensch durch die Tür.“
Doch damit allein gibt sich Nicolas Stemann nicht zufrieden. Er lädt seine Inszenierung mit einem weiteren Spannungsfeld auf. Jeder Schauspieler spielt dabei eine Figur, in der der Schauspieler durch Tschechows Text gefangen ist. Der Schauspieler ist aber zugleich Individuum und Stemann ist daran gelegen, dass er oder sie über die Figur hinausragt. „Man sieht die Figur und die ‚authentische‘ SchauspielerIn.“
| |
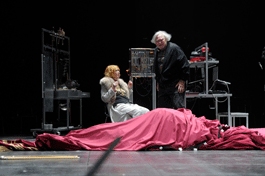 |
|
| |
V.l.n.r.: Ilse Ritter, Peter Brombacher
© Thomas Aurin
|
|
Auf der Bühne sieht das wie folgt aus. Die meisten Darsteller stellen sowohl ihre Figur, als auch sich selbst dar: „Ich glaube, dass die Art wie wir jetzt einerseits den Realismus, den psychologischen Realismus stützen, und andererseits auch immer wieder unterlaufen – so dass man denkt ‚irgendwas stimmt daran doch nicht‘ – diese Dimension öffnet, um die auch Tschechow weiß: die Realität neben der Realität.“ Nun die Frage, was kommt dabei heraus, wenn sich der Zuschauer einigermaßen desorientiert fragt, irgendwas stimmt hier nicht? Kurzum, wie interessant kann schon die Realität der Darsteller sein und wer will, wenn er ein Tschechowstück erleben möchte, diese Realität wissen? Tatsächlich erfahren kann der Zuschauer ohnehin nichts. Vielmehr passiert etwas auf der Bühne, was sich als sehr kontraproduktiv in Bezug auf das Stück herausstellt. Die Schauspieler, von der inszenatorischen Kandare gelassen, und das liegt in der Natur des Berufes, wollen gefallen, stolzieren selbstverliebt über die Bühne und versuchen immer mehr sie selbst, als die Figur zu sein. Ein Spannungsfeld mag das sein, aber im Ergebnis erscheinen sowohl die Figur wie auch Darsteller diffus.
Tschechows Stück ist, wie alle seine Dramen, eine Komödie. Tatsächlich wurde viel gelacht in den 2 Stunden 35 Minuten. Allerdings erheiterten vornehmlich die Kalauer, die Mätzchen, die Selbstdarstellungen der Schauspieler. Im Bayerischen Fernsehen lief gegen Mitternacht Ernst Lubitschs „Sein oder nicht sein“, in dem zwei zu kurz gekommene Knatterchargen immer wieder betonten: „Du sollst einen Lacher nicht verachten!“ Wenn sich die Kammerspiele heftiger Kritik ausgesetzt sehen, dann gewiss nicht wegen intellektueller und ästhetischer Überforderung des Publikums. Da treibt dem Kritiker die Erkenntnis, dass er auf der Suche nach dem Bühnenbild von Katrin Nottrodt erst ziemlich spät begreift, dass der tanzende Vorhang das Bühnenbild ist: Vorhang rot, Kirschen rot – Kirschgarten, die Schamesröte ins Gesicht.
Die Darsteller gingen auch nicht durch Türen oder gar durch ihre Wortkulissen, sondern sie umkreisten einander - nicht in dramatischen Dialogen -, sondern in introvertierter Nabelschau. Heraus ragte am ehesten Peter Brombacher als Lopachin, der bei seinem Anliegen, das Schicksal und die Zukunft des Gutes und des Kirschgartens, eisern blieb. Es war weder bei Ilse Ritter als Gutsbesitzerin Ranjewskaja, noch bei Daniel Lommatzsch als ihr Bruder Gajew ein Anflug von Melancholie auszumachen, die dieses Stück eigentlich trägt. Es geht bei Tschechow nicht nur um den ökonomischen Niedergang einer Familie, sondern um den Untergang einer senilen Kultur. Die neue Kultur, vertreten durch Lopachin, ist die des Neoliberalismus, kalt, nüchtern, pragmatisch. Die Ebene des Kulturverlustes findet in Stemanns Inszenierung nicht wirklich statt. Die Tatsache, dass der Kirschgarten so berühmt ist, dass er im Konversationslexikon aufgeführt ist, wird nicht als Indiz eines Kulturverlustes benannt, sondern, wie so vieles, der Lächerlichkeit preisgegeben. Die Menschen in Tschechows Stücken mögen z.T. lächerlich sein, die Umstände indes sind es nicht. Es wurde vom Publikum auch nicht die Komik der Figuren belacht, sondern die Komik der Schauspieler. Wem das genügte, der war hörbar angetan. So trat anstelle eines Homerischen Lachens ein Comedylachen.
„Irgendwas stimmte nicht“, wohl wahr, denn eigentlich ging nichts zusammen und so folgte man als Zuschauer keiner stringenten Geschichte, sondern schwamm auf Figuren-/Schauspielerbefindlichkeiten dahin, drei Mal aufgeschreckt von aus dem Bühnenboden herabstürzenden Ästen oder Stämmen, das Abholzen des Kirschgartens beschwörend. Als das schier endlose Abschiedsfinale von Samouil Stoyanov als vergessener fast neunzigjähriger Diener mit einer flammenden, aggressiven Kampfesrede beendet worden war, bei Tschechow sagt er: „Kein bisschen Kraft mehr, nichts mehr, nichts … Ach du Windei…!“, erntete das Ensemble und auch Nicolas Stemann und sein Team frenetischen Beifall. Die Atemluft im Zuschauerraum war nach diesem Marathon der Agonie aufgebraucht und man war froh, die klare Luft der frostigen Nacht zu atmen.
Wolf Banitzki
Der Kirschgarten
von Anton Tschechow
Mit: Daniel Lommatzsch, Peter Brombacher, Gundars Āboliņš, Damian Rebgetz, Christian Löber, Hassan Akkouch, Samouil Stoyanov, Annette Paulmann, Julia Riedler, Brigitte Hobmeier, Ilse Ritter, Mariann Yar
Regie: Nicolas Stemann