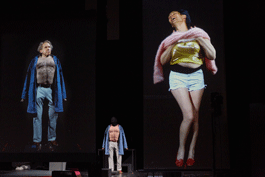Kammerspiele Der Fall Meursault – Eine Gegendarstellung Nach dem Roman von Kamel Daoud
Poetischer Existenzialismus
„Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem: den Selbstmord.“ So lautet der erste Satz in „Der Mythos von Sisyphos“. Dieser philosophische Essay, in dem Camus das Absurde zum wesentlichen Element des Existenzialismus erklärte, erschien 1942 und somit im selben Jahr wie „Der Fremde“. Siebzig Jahre später erschien mit „Der Fall Mersault – eine Gegendarstellung“ des algerischen Autors Kamel Daoud. Soviel vorweg, eine Gegendarstellung zu Camus‘ „Der Fremde“ zu schreiben, ist mehr als mutig. Das kann schnell schief gehen und im künstlerischen Selbstmord gipfeln. Aber, und dieser Gedanke entbehrt nicht einer gewissen Komik, das ist nicht der Selbstmord, den Camus meinte. Dennoch, der Philosoph erwähnte in „Der Mythos von Sisyphos“ folgenden Fall: „Ich habe von einem Nachfolger Peregrinos’ gehört, von einem Nachkriegsschriftsteller, der sich nach Vollendung seines ersten Buches das Leben nahm, um die Aufmerksamkeit auf sein Werk zu lenken. Die Aufmerksamkeit wurde tatsächlich erregt, das Buch aber wurde verrissen.“
Nein, Selbstmord beging Kamel Daoud mit seinem zu Recht sehr erfolgreichen Roman nicht. Es ist auch keine wirkliche Gegendarstellung, sondern ein Prosawerk, das von „Der Fremde“ initiiert und inspiriert ist. Wenn die junge Meriem, Maya Haddat als sehr anmutige und liebenswerte Autorin einer wissenschaftlichen Arbeit über das Buch von Camus, anmerkt, dass die Familie Camus die Aufführung beider Werke, „Der Fremde“ und „Der Fall Meursault“ im selben Kontext verbietet, hat die Familie des Philosophen nicht ganz Unrecht. Das eine Werk ist in der Tat ein philosophisches und kein rein narratives Werk. Das Gegenteil trifft auf „Der Fall Meursault“ zu. Das ist jedoch keine Wertung, wie der Tonfall Meriems unterstellte. Es geht vielmehr darum, dass man Äpfel und Birnen nicht als ein und dasselbe verkaufen kann. Es ist auch nicht wirklich zutreffend, dass der literarische Ruhm von „Der Fremde“, wie gelegentlich behauptet, aus der Namenlosigkeit des Opfers resultiert. Den Ruhm verdankt dieses Buch seiner absoluten Aufrichtig- und Kompromisslosigkeit, die menschliche Existenz als das zu benennen, was sie im philosophischen Verständnis ist: sinnlos. Meursault (Camus), der gleichgültige Mörder bringt es mit dem letzten Satz auf den Punkt: „Damit sich alles erfüllt, damit ich mich weniger allein fühle, brauche ich nur noch eines zu wünschen: am Tag meiner Hinrichtung viele Zuschauer, die mich mit Schreien des Hasses empfangen.“
| |
 |
|
| |
Walter Hess, Maya Haddad, Hassan Akkouch
© Judith Buss
|
|
Kamel Daoud gab dem vom Franzosen Meursault getöteten Mann sowohl einen Namen, Musa, als auch einen Bruder, Harun, und eine Mutter. Letztere, gespielt von Mahin Sadri, hatte etwas Erinnyenhaftes, in schwarz gekleidet, in ihrer Muttersprache lamentierend, das Bild Musas vor der Brust, zog sie zwanzig Jahre ihren Weg auf der Suche nach ihrem Sohn durch die Geschichte, nicht akzeptierend, dass er tot ist. Die eigentliche Trauerarbeit hatte Haroun zu leisten. In der Inszenierung des iranischen Regisseurs Amir Reza Koohestani war er in drei Lebensaltern (auch gleichzeitig auf der Bühne) präsent: Haroun als siebenjähriger (Dennis Kharazmi/Jasper Kohrs), als junger Mann (Samouil Stoyanov) und als alter Mann (Walter Hess). Haroun war die Hauptperson in der Geschichte, denn ihm oblag es, sich zum sinnlosen Tod des Bruders zu verhalten und, so sieht es die gesellschaftliche Konvention und die „ewige Ordnung“ vor, ihn zu rächen.
Harouns erster Auftritt geschah als alter Mann. Walter Hess erschien nur als Kopf auf der Bühne im Angesicht seiner betenden Brüder in der Moschee und erklärte dem Publikum, dass er ein Ausgestoßener sei, denn er glaubt weder an Gott, noch hat er Weib und Kinder und er trinkt gern Alkohol. Auf die Androhung, man werde ihm die Beine ausreißen wegen seiner Gottlosigkeit, antwortete er lakonisch: „Darum bin ich auch nur als Kopf gekommen.“ Und genau diese bisweilen sehr komische Lakonie war es, die die Geschichte und die Inszenierung trug und kurzweilig machte. Dabei hatte sie durchaus einen existenzialistischen Beigeschmack. Am Ende erschoss Haroun den Franzosen Joseph, als dieser sich vor den Aufständischen der algerischen Unabhängigkeitsbewegung auf dem Hof Harouns in Sicherheit brachte. Gundars Āboliņš gab den Joseph, wie er zuvor den Mörder Meursault gab. Dabei ging ihm das Sterben nicht so leicht von der Hand wie die Tötung Musas. Der Paradigmenwechsel dieser Rollen war durchaus ein Indiz für die Absurdität des Daseins. Hier allerdings wurde sie ausdiskutiert. Sinngemäß: „Du hättest doch nur sagen sollen: geh, und ich wäre gegangen.“ „Wir haben dir oft gesagt: geh, und ihr seid nicht gegangen.“ „Aber wenn du es jetzt gesagt hättest, wäre ich gegangen.“ Es wurde noch absurder, als Haroun (Samouil Stoyanov) sich vor dem Polizisten (Hassan Akkouch) für die Tötung rechtfertigen musste. Die Unabhängigkeit war gerade errungen und somit war Haroun nach dem geltenden Gesetz ein gemeiner Mörder, denn Joseph war algerischer Bürger. Einige Tage zuvor wäre der Mord eine patriotische Tat eines Widerstandskämpfers gewesen und somit folgenlos geblieben. An diesem Punkt wurde überdeutlich, dass Amir Reza Koohestani die postkolonialen Positionen überwunden hat, die sich bei Camus noch finden.
Die Inszenierung war ästhetisch sehr ansprechend dank der Ausstattung (Mitra Nadjmabadi) und den eingespielten Videoinstallationen von Meika Dresenkamp. Der poetische Inszenierungsansatz zielte nicht auf einen reinen Plot, den der Zuschauer im Kopf getrost nach Hause tragen konnte. Regisseur Amir Reza Koohestani erklärte diesen Ansatz im Programmheft so schlüssig, dass dem nichts hinzufügen ist: „(…), denn mein Theater folgt keiner kausalen Logik, es ist mehr ein visuelles Gedicht, eine Aneinanderreihung von lyrischen Bildern – ein Mond, zwei Männer, Nebelschwaden, das Geräusch des Meeres – und ein Gedicht verliert seinen Sinn, wenn man sich ihm mit Logik nähert.“
Ein sehenswerter Theaterabend, mit dem die Münchner Kammerspiele die neue Spielzeit eröffneten. Und das überaus zufriedene und freudige Gesicht des Autors Kamel Daoud ließ darauf schließen, dass die Inszenierung der Prosavorlage gerecht wurde. Was will man mehr!
Wolf Banitzki
Der Fall Meursault – Eine Gegendarstellung
Nach dem Roman von Kamel Daoud
Gundars Āboliņš, Hassan Akkouch, Walter Hess, Mahin Sadri, Samouil Stoyanov, Maya Haddad, Dennis Kharazmi/Jasper Kohrs
Regie: Amir Reza Koohestani
Kammerspiele Wut von Elfriede Jelinek
Amüsement im Angesicht des eigenen Todes
Nachdem die für November 2015 geplante Inszenierung „Die Kontrakte des Kaufmanns 2015 ff.“ aus (mir) unerfindlichen Gründen ausgefallen war, nun die Uraufführung von „Wut“ von Elfriede Jelinek. Für die Inszenierung von Jelinek-Stücken/Texten heimste der jetzige Hausregisseur der Münchner Kammerspiele, Nicolas Stemann, in der Vergangenheit viel Lob ein. Das machte neugierig und gespannt. Stemann selbst trat vor Beginn der Vorstellung an die Rampe und erklärte in bester Entertainermanier das Vorhaben: Es handelt sich bei dieser Inszenierung um „work in progress“, sei also noch nicht fertig und ermuntere zugleich dazu, sollte die UA nicht gefallen, in eine spätere Vorstellung wiederzukommen, die dann ganz sicher befriedigender sein wird. Das Stück ist auch kein Stück, sondern ein Text, ohne Rollen, ohne dramatische Strukturen. Weiter erklärte Stemann, dass der Umfang des Textes 120 Seiten (Ohne Absätze, Punkte oder Kommata!) beträgt, den man (wegen einer anderen Formatierung) auf 140 Seiten gekürzt hat und von dem man allerdings noch nicht weiß, wie lange er wirklich dauern wird. Mit ca. vier Stunden muss allerdings gerechnet werden. Und da das Stück keine Pause hat, was eigentlich unzumutbar ist, wird man irgendwann die Türen öffnen. Die Zuschauer können, müssen aber nicht, den Saal verlassen, um Getränke und Speisen zu sich zu nehmen. Diese, und hier wurde ein echtes Tabu gebrochen, dürfen sogar mit in den Zuschauerraum gebracht werden.
Elfriede Jelineks Text verhandelt, vielschichtig mäandernd und mittels Sprachkaskaden, die sich immer wieder aus sich selbst speisten, das Thema Wut. Anlass dafür waren die tödlichen Attentate auf acht Redaktionsmitglieder des Satiremagazins „Charlie Hebdo“, auf zwei Polizistinnen und vier Kundinnen eines Supermarktes für koschere Lebensmittel. Die Autorin beließ es nicht dabei, nur die Wut der Attentäter in den Focus zu rücken, sondern ebenso die der hinterbliebenen Opfer, aber auch die der so genannten Wut-Bürger, der selbsternannten Abendlandretter. Neben der eigenen Wut über die Ohnmacht thematisiert Elfriede Jelinek schließlich sogar die Wut jener Menschen, die all die Wut, die in der Welt umgeht, wütend macht. Letztlich, und das ist immer wieder auch eine der herausragenden Qualitäten in Frau Jelineks Stücken/Texten, wird außerdem die blinde Wut zitiert, die bereits den antiken Helden und Totschläger Herakles veranlasste, anstatt sich gegen seine wirklichen Feinde zu wenden, seine eigene Familie auszulöschen. Tatsächlich sind in und mit den Texten der antiken Mythologien alle Konflikte gezeichnet und alle Geschichten erzählt. So ist die europäische Literatur immer nur Variation zum Thema.
Die Inszenierung beginnt mit der Projektion des berühmten Satzes von André Breton: „Die einfachste surrealistische Tat besteht darin, mit Revolvern in den Fäusten auf die Straße zu gehen und blindlings, solange man kann, in die Menge zu schießen.“ Schade, dass man es dabei beließ, denn wenn schon zitiert wird, sollte man nicht auf halbem Weg innehalten. So fügte Breton in „Zweites Manifest des Surrealismus“ aus dem Jahr 1930 an: „Wer nicht wenigstens einmal im Leben Lust gehabt hat, auf diese Weise mit dem derzeit bestehenden elenden Prinzip der Erniedrigung und Verdummung aufzuräumen - der gehört eindeutig selbst in diese Menge und hat den Wanst ständig in Schusshöhe.“ Was sagt das? Erst einmal, dass sich die Verhältnisse wohl kaum oder nur unzureichend geändert haben und es auch in dieser Welt das „elende Prinzip der Erniedrigung und Verdummung“ gibt. Es bedeutet aber auch, dass dem Menschen unter entsprechenden Voraussetzungen, und die scheinen gegeben zu sein, eine surreale Gewalttätigkeit innewohnt. Also Schluss mit dem ungläubigen Staunen.
| |
 |
|
| |
Julia Riedler, Thomas Hauser, Annette Paulmann, Ensemble
© Thomas Aurin
|
|
Der Zuschauer erlebte, anders als in den Johann Simons-Inszenierungen, der stets bemüht war, die Jelinekschen Texte zu einer stringenten Geschichte zu verweben, eine Nummern-Revue, deren Inhalte sich an den jeweiligen, im Focus stehenden Gruppen von Menschen orientierte. Der Text hat kaum analytische Ansätze und so führte Elfriede Jelinek aus, wie die Wut-Protagonisten in ihre Zustände gerieten. Der Terrorist braucht keine tieferen Einsichten, die hat der Imam für ihn gehabt, er, der zum Teil Selbstermächtigte spiegelt sich in seiner Unverletzlichkeit, die ihm die selbstzerstörerische Gesinnung verleiht. „Das jetzt, das ist unser Moment! Ihr hattet eure Zeit, jetzt ist es unsere! Seht her und sterbt!“ Der Wutbürger gerät bei den ersten Fragezeichen aus dem Tritt in seinem Kälbermarsch, wie Brecht den Gesinnungsfaschismus charakterisierte, was ihn aber von seinen tumben Begründungen jedoch nicht zu trennen vermag. Eher kriegt der Frager eins auf die Fresse, als dass man sich in seinen unerschütterlichen Wahrheiten irritieren lässt. Ohne Frage ein probates Mittel, das Geschichte gemacht hat. Die wütenden Fragen derer, die den Taten ohnmächtig gegenüberstehen, verhallen ungehört, denn ein wesentliches Merkmal von Wut ist, dass sie taub macht. Immer wieder verirrt sich der Text zu anderen Krisenherden: das Internet, in private Beziehungen, nach Griechenland oder Ruanda.
Grundtenor der Texte ist Entsetzen und Ratlosigkeit. Also jegliche Erwartung, Antworten zu bekommen, sollten zurück geschraubt werden. Was auf der Bühne passierte, war theatralisch aufgeheizte Medienrealität. Dabei ging es über weite Strecken auch recht lustig zu. Nicolas Stemann machte es möglich. Nachdem bereits in der Introduktion über die „offene Form“ der Inszenierung parliert worden war, ging es unverbindlich weiter. Spielort war, sinnfällig für eine Betroffenheitsrevue, eine große holzfarbene Revuetreppe, gekrönt von einem dominant leuchtenden, grinsenden Smiley. Links ein Piano, rechts von der Treppe die Perkussionsinstrumente und blinkende Klangerzeugungselektronik. Davor ein paar Sessel, Sofas und Tischchen. Für die Bühne zeichnete Katrin Nottrodt verantwortlich. Viele Umzüge fanden auf offener Szene statt und es wurden auch Rauchpausen eingelegt. Angesichts so laxer Abläufe, die nicht selten den Eindruck von Privatheit erweckten, erscheint der Satz von Matthias Lilienthal, „Die Schauspieler fühlen sich wohl auf der Bühne.“ glaubhaft. Es wurde über weite Strecken aus den Textbüchern gelesen, was den Ausschluss von gestischer Darstellung bedeutete. Es ist schon erstaunlich, wie leicht so hochkarätige Schauspieler zum Verzicht ihrer künstlerischen Mittel, die sie so einzigartig machen, verführt werden können.
Bei Annette Paulmann hat das allerdings nicht geklappt. Diese scheinbar unzerstörbare Komödiantin hat mit ihrer Eifersuchtsszene schmerzlich spürbar gemacht, worauf weitestgehend verzichtet wurde, ästhetischer Genuss und glaubhafte menschliche Figuren. Ähnlich markant waren zudem die Gesangseinlagen von Jelena Kuljić, von der man spätestens seit „La Somnambula“ weiß, was sie auch darstellerisch zu leisten vermag. Ansonsten unterwarf man sich einer Ästhetik, die auf Vorstellung und nicht auf Darstellung setzte. So verwandelten sich die Schauspieler zu Beginn in Clowns (Kostüme Katrin Wolfermann), um diese harmlose Vorstellung bald wieder zu zerstören, als die Bewaffnung mit Kalaschnikows vollzogen war. Das erinnerte stark an Banksy „Insane Clown“. Streetart scheint den Kammerspielen momentan ohnehin näher zu sein, als Theatertradition. Wer es noch nicht wusste, erfuhr nebenher auch gleich, wie die Mechanik einer vollautomatischen Waffe funktioniert.
Ein anderes ästhetisches Highlight war der Auszug der Teenekämpferinnen in den „Heiligen Krieg“, schrillbunt und quietschig von Jelena Kuljić, Julia Riedler und Zeynep Bozbay gegeben. Diese Szene erzeugte einige Heiterkeit. Gegen Ende übersetzten die Schauspieler die Metapher „Shitstorm“ in die Realität; sie schieden auf der Bühne Fäkalien aus und bewarfen damit Projektionen von anderen Schauspielern. Richtig lustig war es in der Pause, als eine Göttersatire (nicht von Frau Jelinek) gegeben wurde. Da trat Jesus auf, dessen Kreuz zugleich ein Selfiestick war, und zeigte, wie man über Wasser gehen kann oder auch Heerscharen von Hungernden satt macht. Buddha führte vor, wie man schweigt oder denkt. Als allerdings Mo (Mohammed) im Minirock auftauchte, kippte die Geschichte wieder zurück in den Hass, denn seine Darstellung ist ja bekanntlich verboten und ruft sofort die Verteidiger des wahren Glaubens auf den Plan.
Schließlich nahm Nicolas Stemann mit Gitarre und die Musiker Thomas Kürstner und Sebastian Vogel auf dem Pausentalksofa Platz, um die Geschichte mit weiteren aktuellen Themen aufzuladen. Da durfte natürlich Böhmermann nicht fehlen. Wer glaubte, dass nach Götter-Satire und Fraueneifersüchteleien nun Gesellschaftssatire geboten würde, ging leer aus. Mit wenig dezenter Herablassung und einiger Selbstgefälligkeit erging man sich musikalisch und kalauernd. Einsichten, die Satire, wie kaum ein anderes Medium, befördert, blieben aus. Allein, den Anhängern dieser Theaterauffassung und der dazugehörigen Ästhetik gefiel es derart, dass sie die Inszenierung und alle Beteiligten nach dreidreiviertel Stunden frenetisch feierten. Die Zuschauer, die damit nicht einverstanden waren, hatte die Pause genutzt und den Heimweg angetreten.
Bei Inszenierungen von Texten Elfriede Jelineks muss man stets mit Überraschungen rechnen. Dass man mit Realität nicht rechnen kann, liegt auf der Hand, denn Elfriede Jelinek selbst ist nicht in der Realität. Dazu bekennt sie sich in ihrem Text. Dennoch können ihre hochpoetischen Denkkonstrukte durchaus hilfreich sein für die Orientierung im Umgang mit der Realität. Dass das Thema Wut und Terrorismus allerdings so viel Heiterkeit erzeugen kann, damit war nicht zwingend zu rechnen. Es ist auch fraglich, ob Frau Jelinek damit einverstanden wäre, denn eine Botschaft, so sie sie hineingeschrieben hat, kam nicht über die Rampe. Immerhin macht diese Inszenierung deutlich, dass es kaum ein Thema gibt, und sei es noch so barbarisch und deprimierend, das nicht für Entertainment taugt. Die These des großen Medienkritikers Neil Postman „Wir amüsieren uns zu Tode!“, hat längst den nächsten Level erreicht und lautet: „Wir amüsieren uns im Angesicht des eigenen Todes!“
Wolf Banitzki
Wut
von Elfriede Jelinek
Daniel Lommatzsch, Jelena Kuljić, Thomas Hauser, Julia Riedler, Annette Paulmann, Franz Rogowski, Zeynep Bozbay
Inszenierung: Nicolas Stemann
|