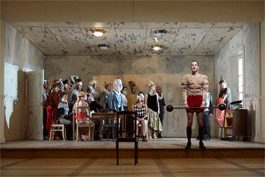Kammerspiele Der Spieler nach dem Roman von Fjodor Dostojewski in der Übersetzung von Swetlana Geier
Drei lange Stunden
Mit „Der Spieler“ kam an den Kammerspielen, nach „Schuld und Sühne“ am Volkstheater, die zweite Dostojewski-Adaption innerhalb von zwei Wochen auf eine Münchner Bühne. Zufall? Wohl kaum, denn große Literatur ist zeitlos und deren Themen bleiben stets aktuell, denn sie reflektieren menschliche Unzulänglichkeiten, die, wie es scheint, unausrottbar sind und die in dramatischen Konflikten stets aufs Neue verhandelt werden müssen. Dostojewskis Romane sind, was die Form und Sprache anbelangt, nicht unbedingt genialische Werke. Wladimir Nabokov erhielt einmal von einem Schweizer Verleger den Auftrag, eine Anthologie der besten russischen Schriftsteller zusammenzustellen. Mit Entsetzen stellte der Mann fest, dass Nabokov Dostojewski übergangen hatte. Nabokov rechtfertigte sich sinngemäß, kein Werk Dostojewskis sei es wert, in eine Anthologie aufgenommen zu werden, es sei denn, man nehme das Gesamtwerk auf. Dostojewskis Werk zeichnet sich durch eine unvergleichliche Komplexität aus, mit der er beinahe alle Aspekte des menschlichen Lebens und der Gesellschaft beleuchtete und nuanciert, tief und breit, gelegentlich auch geschwätzig, spiegelte. In „Der Spieler“ tat er das aus ureigener Erfahrung. 1865 reiste der Schriftsteller zum dritten Mal nach Westeuropa. Er wurde von seiner jungen Geliebten Polina Suslowa begleitet. In der Spielbank in Wiesbaden verspielte er am Roulettetisch 3000 Rubel, seinerzeit ein kleines Vermögen.
Die Versuchung, allein durch Spiel zu Reichtum zu gelangen, war zu allen Zeiten übermächtig. Bereits Tacitus (55 – 120) legte in seiner „Germania“ Zeugnis ab über die selbstzerstörerische Hemmungslosigkeit unserer Vorfahren, das Würfelspiel betreffend: „Dabei sind sie in Bezug auf Gewinn oder Verlust von einer so blinden Leidenschaft, dass sie, wenn sie alles andere verspielt haben, mit dem letzten entscheidenden Wurfe um ihre Freiheit und um ihre eigene Person kämpfen. Wer verliert, geht willig in die Knechtschaft, (…), er lässt sich binden und verkaufen.“ (Publius Cornelius Tacitus: Germania. Kapitel 25) Warum der Blick in die ferne Vergangenheit? Um vorab schon einmal klar zu stellen, dass Spiel eine, wenn auch zweifelhafte, kulturelle „Errungenschaft“ ist und kein maßgebliches Charakteristikum des Kapitalismus. So ist „Roulettenburg“ ein Topos der Versuchung, nicht aber das Herz des goldenen Kalbs. Und so ging es Dostojewski nicht darum, das Wesen des Kapitalismus zu entlarven, sondern das Wesen einer Krankheit, der er selbst verfallen war.
Die Frage nach dem sozialen Status war und ist fraglos an Besitz gekoppelt, zumindest in Gesellschaften, in denen die Mitglieder durch Besitz voneinander geschieden sind. So lässt Dostojewski seinen Protagonisten Aleksej Iwanowitsch, Hauslehrer beim General Sagorjanski, dessen Stieftochter und Angebeteten rigoros erklären: „Sie fragen, wozu ich Geld brauche? Was heißt – wozu? Geld ist alles.“ Würde er sich an dieser Stelle erklären und ihr seine Liebe gestehen, nähme die Geschichte vielleicht eine andere Wendung. Stattdessen erklärt er ihr, was der Besitz von Geld ihm bedeutet: „Es ist weiter nichts, als dass ich im Besitz von Geld auch für Sie ein anderer Mensch und kein Sklave sein werde.“ Das Schicksal, durch das Geld, resp. den Besitz desselben voneinander geschieden zu sein, teilen Aleksej und Polina mit dem General und Mademoiselle Blanche, er, vom Spiel ruiniert, aber in Erwartung eines Erbes, sie auf der Suche eines verlässlichen Versorgers. Chancenlos, wie sich herausstellt, denn die Großtante, die einzige Vermögende, verbietet dem General die Ehe und droht, bei Zuwiderhandlung ihr Vermögen am Spieltisch zu verschleudern. Blanche bleibt zuletzt an dem Franzosen Marquis des Grieux hängen, der sie zwar versorgt, ihr Bedürfnis nach Liebe aber nicht stillen kann. Das Dilemma ist vollkommen und lässt niemanden aus. Einzig der Engländer Mr. Astley bleibt von der Spielsucht verschont. Er hält Anteile an einer Zuckersiederei und verdient sein Geld. Er arbeitet; zumindest ist er wertschöpfender Unternehmer.
| |
 |
|
| |
Thomas Schmauser, Niels Bormann, Anna Drexler, Ivana Uhlířová, Zoë von Weitershausen
© David Baltzer
|
|
Christopher Rüping, Jahrgang 1985, wird von der kommenden Spielzeit Hausregisseur an den Münchner Kammerspielen sein. Er gab mit seiner Inszenierung gleichsam seinen Einstand. Der fiel beinahe wie erwartet aus, denn Intendant Lilienthal hat sich bei der Wahl seiner Regisseure dafür entschieden, die Kammerspiele gänzlich umzukrempeln, Ensembletheater ist perdu, offene Formen werden ebenso bevorzugt wie alternative. Anstelle des ästhetisch in sich geschlossenen Kunstwerkes, an das sich der Zuschauer noch nach Jahren deutlich erinnert wie an ein großartiges Gemälde, ist eine Diskurskultur getreten, bei der Politik oder zumindest politische Einflussnahme zelebriert wird. Das ist ihm in den ersten fast hundert Tagen vortrefflich gelungen, allerdings um den Preis, dass viel Theater, wie man es liebte, verlustig ging.
Christopher Rüping selbst gab (widerwillig) im Programmheft Auskunft zu „Der Spieler“. Sehr deutlich wird darin der Widerwille erklärt: „Immer wieder stoßen wir beim Proben auf neue Gedanken, die die alten überschreiben. Alles ändert sich, nur diese Zeilen (im Programmheft – Anm. d. Verf.) nicht. Die lasten wie ein Grabstein auf unserem Abend. Oder wie Atommüll. Jedenfalls wie nichts Gutes.“ Es folgen Gedankenbrocken, aufgereiht wie zu einem Parcours. Hat man die Inszenierung gesehen, versteht man, was Rüping damit meinte, denn der Abend ließ eins mit Sicherheit vermissen, ein durchgearbeitetes, schlüssiges Konzept. Es war also eine in den Proben gewachsen Inszenierung. Das Ergebnis sah wie folgt aus: Fünfzig Minuten wurde die Szene von den Kindern Mischa und Nadja, gespielt von Nikolai Huber, Jasper Kohrs, Zoë von Weitershausen und Marlene Witzigmann dominiert. Ihretwegen war Aleksej vom General als Hauslehrer engagiert worden. Joachim Wörmsdorf, Souffleur, er stellte gleichsam den schweigsamen Mr. Astley vor, entrissen die Kinder das Textbuch und veranstalteten eine szenische Lesung. Sie waren bezaubernd anzuschauen und durchaus unterhaltsam in ihrer Unbefangenheit und Originalität. In dieser Zeit wurde auch das Bühnenbild von Jonathan Mertz, bestehend aus zu Videowänden aufgestapelten Umzugskartons, mehrfach umgeräumt und schließlich zum Einsturz gebracht.
Dann gab es für zehn Minuten Theater, das fesselte. In diesen zehn Minuten entblätterten Anna Drexler als Polina und Thomas Schmauser als Aleksej ihre zarte Beziehung zueinander und diskutierten die oben bereits zitierte Passage zum Thema: Was bedeutete Geld. Die Szene endete damit, dass Polina Aleksej aufforderte, einer deutschen Baronin einen französischen Satz ins Ohr zu hauchen, um deren Gatten zu entzürnen. Sie wollte sich daran weiden, wie Aleksej vom Baron mit dem Stock gezüchtigt werden würde. Thomas Schmauser stieg von der Bühne und sprach seinen Satz in das Ohr einer Zuschauerin. Vermutlich war es: „Madame, j'ai l'honneur d'être votre esclave.“ Im Roman ist das der Wortlaut. Dann kamen alle anderen Darsteller auf die Bühne und prügelten eine Weile mit Schaumstoffschlangen aufeinander ein. Kurz vor Ende des ersten Teils verwandelte sich Thomas Schmauser mittels Rock, Perücke und einer schrillen Stimme in die vermeintlich sterbende, aber dann doch mopsfidele Großtante und hängte die ganze Bagage hin. Das geschah im wahrsten Sinn des Wortes. Die Darsteller baumelten zur Pause und auch danach auf halber Höhe der Bühne.
Substanzieller wurde es auch nach der Pause nicht. Die Darsteller, insbesondere Thomas Schmauser, von der spielleitenden Leine gelassen, blödelten sich mit großem körperlichen Aufwand und schrillen Manierismen durch den Roman. Dabei wurden die Figuren nicht deutlicher. Gundars Āboliņš, der den General gab, war schon zu Beginn in einen lächerlichen Tanzbären verwandelt worden. Niels Bormann, ein Schauspieler mit einer exzellenten Präsenz, hatte seine großen fünf Minuten am Ende, als er, eigentlich Marquis des Grieux, sitzend und ohne Überflüssigkeiten den Text des Mr. Astley sprach, mit dem der Roman endet. Dabei stellte und beantwortete er sich selbst die Fragen Aleksejs. In diesem Augenblick begriff man als Zuschauer, was einem eigentlich vorenthalten worden war.
Die Inszenierung, die lebendig sein wollte, war zappelig und konfus. Ästhetisch ging kaum etwas zusammen und die Geschichte, eine große Geschichte, löste sich in Plattitüden auf. Dabei fand man die Einfälle der Kinder, die sie in den Probenpausen nebenher aufs Papier gekritzelt hatten, immerhin so witzig, dass man sie einbaute. So fragte sich Großtante Schmauser auf der Toilette, wo denn wohl die Roulette sei. Wenn man weiß, woher einige der Einfälle kamen, erübrigt es sich natürlich, der Inszenierung Infantilität vorzuwerfen. Immerhin war alles korrekt englischsprachig übertitelt, was dem Spektakel (Ein Wort, das mehrfach im Text vorkam!) zwar kein internationales Format, jedoch dem Theater den Anstrich von Weltoffenheit verlieh. Drei lange Stunden und die Begeisterung hielt sich bei dem nach der Pause noch verbliebenen Publikum der zweiten Vorstellung in Grenzen.
Wolf Banitzki
Der Spieler
Nach dem Roman von Fjodor Dostojewski in der Übersetzung von Swetlana Geier
Gundars Āboliņš, Niels Bormann, Anna Drexler, Thomas Schmauser, Ivana Uhlířová, Kaspar Huber, Nikolai Huber, Jasper Kohrs, Zoë von Weitershausen, Marlene Witzigmann, Joachim Wörmsdorf
Regie: Christopher Rüping
|
Kammerspiele Rocco und seine Brüder nach dem Film von Luchino Visconti in einer Fassung von Simon Stone
Wenig hilfreich zum Thema Migration
Luchino Viscontis breit angelegtes Filmepos, Bestandteil einer filmischen Süditalien-Trilogie, ist in Schwarz-Weiß gedreht und gilt als ein Spätwerk (erschienen 1960) des italienischen Neorealismus. Noch im Erscheinungsjahr bei den Filmfestspielen in Venedig preisgekrönt, fand es erst 1993 (ZDF) den Weg in deutsche Wohnzimmer. Allein schon wegen der tragisch überhöhten Geschichte wurde das Sozialdrama in Italien ein kommerzieller Erfolg und verhalf sowohl dem Regisseur zu großer Anerkennung, wie auch dem Darsteller des Roccos, Alain Delon, zum künstlerischen Durchbruch. Der Film schockierte seinerzeit wegen der dargestellten Brutalität und des Pessimismus, den er verbreitete, und musste geschnitten werden.
Die Geschichte blieb immerhin so aktuell, dass sie 2008 in der dramatischen Bearbeitung und der Regie von Ivo van Hove in der Jahrhunderthalle Bochum uraufgeführt wurde. Nebenbei: Ivo van Hove inszenierte 2013 „Seltsames Intermezzo“ von Eugene O'Neill und 2011 „Ludwig II“ nach dem Film von Luchino Visconti an den Münchner Kammerspielen. Jetzt nun besorgte der 1984 in der Schweiz geborene, junge australische Autor/Regisseur Simon Stone eine Bearbeitung und Inszenierung für die Kammerspiele. Er wird vor allem wegen seiner „radikalen Neubearbeitungen von klassischen Texten“ in der Theaterszene hoch gehandelt. Ohne Frage kann man Viscontis Vorlage schon als Klassiker (der Moderne) bezeichnen, bei Stones Überarbeitung von radikal zu sprechen, wäre dann doch übertrieben.
Die Geschichte wurde in den Grundzügen und Konflikten unverändert übernommen. Einziger bedeutsamer Unterschied war, dass die Witwe Rosaria Parondi mit ihren Söhnen Rocco, Simone, Ciro und Luca nicht mit dem Zug aus dem süditalienischen Lukanien nach Mailand anreisten. Diese konkrete Topografie hatte Stone aufgehoben. Bei ihm kamen die Witwe und deren Kinder aus einem unbekannten Land in einer unbekannten Stadt an. Man könnte München getrost als Ankunftsort annehmen. Der fünfte und älteste Sohn Vincenzo war schon vor längerer Zeit voraus gereist und am Abend der Ankunft seiner Familie feierte er gerade seine Verlobung. Es kam zum Streit zwischen den Familien und zum Zerwürfnis. Der Familie Parondi wurde eine Sozialwohnung zugewiesen und Vincenzo bemühte sich, seine Brüder in „Brot und Lohn“ zu bringen. Durch Vincenzo kamen Simone und Rocco mit dem Boxsport in Berührung. Zumindest für Simone verhieß der Sport sozialen Aufstieg, zumal er schnell Erfolg hatte und Geld verdiente. Die Prostituierte Nadia wurde für alle zum Prüfstein, denn Simone verliebte sich in die anziehende Frau, die jedoch Rocco den Vorzug gab. Simone, längst auf die schiefe Bahn geraten, vergewaltigte Nadia, um seinen Besitzanspruch zu definieren, und schlug den Bruder brutal zusammen. Rocco sah die Schuld bei sich und übernahm die Schulden seines Bruders, in dem er sich im Boxstall für lange Zeit verpflichtete und in die „moderne Sklaverei“ ging. Als er im Zenit seiner Leistungen anlangte, befand sich Simone auf dem Tiefpunkt. Er stach Nadia, die wieder auf dem Strich arbeitete und nur Verachtung für Simone hatte, nieder. An diesem Punkt wurde unwiderruflich deutlich, dass die Familie, die einzig verlässliche Stütze für diese Menschen, zerbrochen war. „Wir sind Feinde geworden.“ Dennoch gab es einen Hoffnungsschimmer, denn Ciro war es durch Schulbesuch und unbeugsamen Willen gelungen, einen Beruf zu erlernen und eine Arbeit zu bekommen. Er gab seine gewonnenen positiven Einsichten an den jüngsten Bruder Luca weiter.
| |
 |
|
| |
Thomas Hauser, Christian Löber, Samouil Stoyanov, Johannes Geller, Wiebke Puls
© Thomas Aurin
|
|
Ralph Myers Bühnenbilder beschränkten sich auf das Wesentliche. Berge von Taschen beschrieben die Ankunft der Migranten, die voller Hoffnungen in die Stadt kamen. Sie fielen auf in ihren Jogginganzügen und schnell wurde deutlich, dass es ein Unmenge Codes gibt, die beachtet und eingehalten werden wollen, um einer automatischen Ausgrenzung zu entgehen. (Kostüme Henriette Müller) Ein Fitnesscenter beschrieb den Boxclub, ein Sandsack, ein Laufband, eine Hantelbank etc. Weit entfernt von der Stadt, Rocco absolvierte seinen Militärdienst, traf er zufällig auf Nadia, die eine Haftstrafe abgesessen hatte. Der romantische Ort der Annäherung war ein vergammeltes Autowrack. Am Ende stand schließlich der Boxring, in dem Nadia zu Tode kam und Rocco seine Siege feierte. Das konnte durchaus metaphorisch gesehen werden, denn dieser Kampfplatz stand für das Leben schlechthin. Willkommen in der neoliberalen, glitzernden Welt, in der der Sozialdarwinismus betörende Geschmacksrichtungen hat.
Die wichtigste Qualität der Inszenierung war ihr Rhythmus. Die Szenen, Handlungsorte wurden als Überschriften eingeblendet, gingen fließend ineinander über. Regisseur Stone trieb die Geschichte atemlos voran und verlangte den Darstellern viel Bewegung und Körpereinsatz ab, ohne dabei jemals ins Chaos abzugleiten. Immerhin ging es über weite Strecken auch um Boxen. Es fällt (mir) schwer, Boxen noch immer als Sport zu bezeichnen, denn letztlich geht es nur darum, dem Gegner mittels Schlägen auf den Körper oder gegen den Kopf, die durchaus auch tödlich sein können, das Bewusstsein zu rauben. Es lässt gleichsam tief blicken, dass sich dieser Sport wieder enormer Beliebtheit auch bei Intellektuellen und Künstlern erfreut, bedeutet er doch ganz unmittelbar: „Survival of the fittest.“ Aber wie auch in dieser Gesellschaft, ist in vergangenen Gesellschaften das Gladiatorentum stets Ausdruck von Dekadenz gewesen. Traurig ist, dass die, die häufig die ungünstigsten Voraussetzungen in der Gesellschaft haben, von den Begüterten dafür entlohnt werden, dass sie sich vor aller Augen und zum Amüsement überdrüssiger Wohlstandsbürger gegenseitig zerfleischen. „Moderne Sklaverei“ trifft es. Den Verheißungen von Glanz und Glamour gehen vor allem Migranten auf dem Leim, die mit dem Verkauf ihrer Körper ihre Misere zu überwinden suchen.
Es ist unbestritten ein brisantes Thema, angesichts der Zuwanderung. Allein, die Wirkung der Inszenierung in den Kammerspielen reichte an die des Films längst nicht heran. So sehr sich die Darsteller auch mühten mit gekreischten Gefühlsausbrüchen wie Brigitte Hobmeier als Nadia oder Samouil Stoyanov als rummelboxerhaft, balztänzelnder Simone, sie blieben nur „prollige“ Varianten der Rollen. Verglichen mit der darstellerischen Eleganz einer Annie Girardot oder dem Dynamitbrocken Renato Salvatori waren sie nur Abziehbilder. Selbst Wiebke Puls als Mutter Rosarie kam über das Plakative nicht hinaus. Da war die bubenhafte Natürlichkeit von Johannes Geller als jüngster Bruder Luca geradezu wohltuend. Christian Löbers Ciro, die moralische Instanz im Stück, vermochte in seiner Weinerlichkeit kaum Hoffnung zu verbreiten. Der Grund, warum keine wirkliche Tiefe erzeugt werden konnte, war wohl in der Sprache zu suchen. Einerseits enthielt sie Wendungen, und mit Wendungen sind durchaus Richtungsänderungen gemeint, die verblüfften und Witz hatten, andererseits war sie bis zum Erbrechen mit Vulgarismen aufgeladen, die banalisierend wirkten. Sollte das ein neuer Realismus sein, mit dem Einwanderer charakterisiert werden? Oder meinte jemand, mit derartigen Mitteln gegen den „guten bürgerlichen Geschmack“ anrennen zu müssen? Diese Form der Provokation hatte keine wahrheitsbefördernde Qualität und langweilte nur. Was ist eigentlich daran auszusetzen, dass Kunst (des Wortes) eigentlich etwas mit Sprachpflege zu tun haben sollte. - Vor allem, wenn tausende Migranten ins Land strömen, die diese Sprache lernen sollen. Bei Visconti gibt es keinerlei sprachliche Entgleisungen und trotzdem würde niemand auf die Idee kommen, es sei langweilig oder fade.
Sprache ist materialisiertes Denken und verräterisch. Eine rohe Sprache impliziert rohes Denken. Unlängst sagte der deutsche Fußball-Bundestrainer im Rundfunk: „Wir waren nicht tödlich genug für unseren Gegner.“ Das ist so eine sprachliche Aufrüstung, auf die niemand reagiert hat, wohl, weil es gefällt. Die fortschreitende Brutalisierung ist nicht nur an der zunehmenden Zahl von Kriegs- und Krisenherden abzulesen, sondern auch an der alltäglichen Sprache. In der Wirtschaftsprache und in Unternehmenskommunikation hat Kriegsrhetorik beispielsweise längst einen festen Platz. Die Inszenierung von Simon Stone lebte nicht zuletzt auch von einer Brutalisierung durch Vulgarisierung der Sprache. An dieser Stelle trifft die Aussage über Stones „radikalen Neubearbeitungen von klassischen Texten“ allerdings zu. Es mag sein, dass in dieser „sozialen Schicht“ so gesprochen wird. Wenn man es aber dergestalt auf die Bühne bringt, liegt die Vermutung nahe, dass die Entstellung der Sprache sehr bewusst darauf zielt, ein gänsehäutiges Gruseln zu erzeugen, wie es sich einstellt, wenn man sich wilden Tieren gegenüber sieht und nicht genau weiß, ob der Zaun, der sie unter Kontrolle halten soll, auch tatsächlich stabil genug ist.
Wolf Banitzki
Rocco und seine Brüder
von Simon Stone
Wiebke Puls, Franz Rogowski, Samouil Stoyanov, Thomas Hauser, Christian Löber, Johannes Geller, Brigitte Hobmeier, Gundars Āboliņš, Stefan Merki, Hannah Schutsch, Maj-Britt Klenke
Regie: Simon Stone