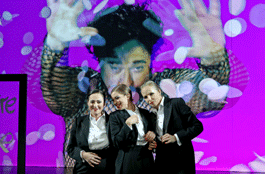Marstall Kassandra/Prometheus. Recht auf Welt UA von Kevin Rittberger
Europa im Dilemma
Es ist die Geschichte eines Dilemmas. Europa hatte sich in den letzten Jahrzenten zu einem verlässlichen Hort der Freiheit, Gleichheit und Demokratie entwickelt. Und es „rechnete sich“, auch wenn es mal eine Bankenkrise oder die üblichen zyklischen Krisen gab. Unterm Strich ging es kaum jemanden auf der Welt so gut wie den Europäern. Es geht den Europäern so gut, weil die ganze Dritte Welt, um diesen unsinnigen Begriff einmal zu benutzen, stramm stand und noch immer steht für den Wohlstand Europas. Europa zerstörte die Landwirtschaften dieser Länder, fischte deren Gewässer in industriellem Ausmaß leer, gab ihnen Kredite, damit sie den Europäern ihren überflüssigen Plunder abkauften und müssen nun aufgrund ihrer immensen Verschuldung ihre Ressourcen, ihren eigentlichen Reichtum, zu Spottpreisen verhökern. Darum „rechnet es sich“ für Europa und an Orten, wo es nicht einmal genug zu essen gibt, wo Ausnahmezustände herrschen, fahren Warlords und korrupte Politiker mit deutschen Nobelkarossen herum und bunkern ihr Geld, das sie aus ihren ohnehin schon besitzlosen Landsleuten herausgepresst haben, in europäischen Banken. Auch für die „rechnet es sich“. Wenn dann aber der Punkt kommt, an dem Menschen nichts mehr an materiellen Dingen und an Sinn zum Leben übrig bleibt, setzen sie ihr Leben freiwillig aufs Spiel, dann kommt Ungehorsam auf, dann laufen sie los und fordern ihren Teil ein, denn sie sind Erdenbürger wie die Europäer auch.
Und da Europa ein verlässlicher Hort der Freiheit, Gleichheit und Demokratie ist, breitet es erst einmal symbolisch die Arme aus: Seid umschlungen, Millionen! Doch als dann die Schatten der Flüchtlinge am Horizont erschienen, begriff man, dass das wichtigste Kriterium der Wahrheit eingetreten war, nämlich die Praxis. Die erste Einsicht der Idealisten war: Das „rechnet sich nicht“ mehr!, denn praktisch ging es jetzt ans Teilen, und zwar zu Ungunsten derer, die besitzen. Eigentlich kam es gar nicht wirklich dazu, denn die meisten Realeinkommen sind kontinuierlich weiter gestiegen und die Reichen sind deutlich reicher geworden. Aber allein der Anschein genügte, um Verunsicherung aufkommen zu lassen.
Es ist eine menschliche Grundeigenschaft, dass der moderne Homo sapiens geradezu nach negativen Nachrichten giert und positiven kritisch gegenübersteht. Wäre Europa tatsächlich der Hort der Freiheit, Gleichheit und Demokratie, der es vorgibt zu sein, würden die Bürger vor Sorge um die Flüchtlinge, um die Kinder, Frauen und alten Menschen, die tagtäglich irgendwo im Meer, in der Wüste, in irgendwelchen Camps klammheimlich verrecken, nicht mehr in den Schlaf kommen. Wenn der Bürger in Europa Nächtens nicht in den Schlaf kommt, dann vor Angst um seinen eigenen Besitz, um seinen Arbeitsplatz, um seine Privilegien. Und hier offenbart sich unweigerlich das Dilemma. An dieser Stelle folgen viele Bürger willig den neuen Propheten, die gern bereit sind, sich stellvertretend für die europäischen Bürger die Hände schmutzig zu machen, und der Flüchtlingswelle entschieden entgegen zu treten. Dann heißt es: Seid ausgegrenzt, Millionen. Es ist peinlich, aber „es rechnet sich“.
Kevin Rittberger versuchte in seinem zweiteiligen dramatischen Entwurf Klarheit darüber zu schaffen, warum Europa so jämmerlich versagt. Dazu bedient er sich zweier Mythen. Im ersten Teil: „Kassandra oder die Welt als Ende der Vorstellung“, ist es das Phänomen der Prophetie und deren Wirkungslosigkeit. Seit Jahrzehnten gibt es die Warnrufe in Bezug auf Instabilitäten, die zu Völkerwanderungen führen werden. Und was die Welt jetzt erlebt, ist erst der Anfang. Rittberger sammelte an spanischen Stränden, in der libyschen Wüste Geschichten, die das Ausmaß des inhumanen Zustands unserer Welt dokumentieren. Regisseur Peter Kastenmüller fasste diese Geschichten in einen ästhetischen Rahmen, der nicht beschrieb, sondern analysierte und erkundete. Dabei bediente er sich der Methoden des epischen Theaters von Brecht. Er baute ein Lehrstück ein, in dem Massiamy Diaby, Florian Jahr, Delschad Numan Khorschid, Noah Saavedra und Yodit Tarikwa chorisch das Problem durchmaßen, um für sich selbst zu Einsichten zu gelangen. Es entsprach durchaus der Theorie von Brecht.
 |
||
|
Delschad Numan Khorschid, Noah Saavedra, Hanna Scheibe, Florian Jahr, Mareike Beykirch © Birgit Hupfeld |
Die Quintessenz einer denkbaren praktischen Lösung sollte sein, dass Nachrichten, Filme, Meldungen lanciert werden sollten, die auf der anderen Seite des Mittelmeeres darüber aufklären sollten, wie gefährlich, ja, zumeist tödlich das Unterfangen einer Überquerung sei. Dieser Ansatz ist natürlich eine Bankrotterklärung der europäischen Politik, die damit begann, dass man den „Schutz der europäischen Grenzen“ outsourcte und an „Frontex“ übergab. Und an dieser Stelle war ein zusätzliches Geschäftsmodell geboren, das sich zumindest für diese Agentur rechnete. In fünfundsiebzig Minuten spulten die Darsteller eine Vielzahl von Szenen voller ungeheuerlicher Grausamkeit ab, die mit Sicherheit einen großen Wahrheitsgehalt haben und die eines mit Gewissheit beweisen, nämlich dass alle Warnungen, alle Horrorszenarien die Flüchtlinge nicht davon abhalten werden, zu kommen. Warum auch, sie haben schlichtweg nichts mehr zu verlieren. Auch das ist ein Hebel der Ökonomie, ein übermächtiger zudem.
Auf der Bühne von Alexander Wolf gab es militärische Landungssperren, wie sie an Stränden, aber auch im offenen Feld gegen Panzer zur Anwendung kommen. Ein zweistöckiger Turm war Wach-, Aussichts- und Festungsturm zugleich. Von ihm aus konnte man über das Meer schauen und Botschaften ins Land senden. Ein Fallgitter konnte blitzschnell zur Grenzbarriere errichtet werden mit der Aufschrift „Warnung“. Der Bühnenhintergrund war mit Ketten verhängt und davor befand sich ein Guckkastentheater mit Brecht-Vorhang. Letzteres stand auch für Medien, in dem sogar ein Choral gesungen wurde vom „Kapitalismus und den Interessen“ oder dessen Vorhang als Projektionsfläche diente, um konkrete Personen oder auch Utensilien schattenrissartig abzubilden.
Auf einer Projektionsfläche im Bühnenhimmel wurden winzige Bilder wie von Schreibmaschinentypen gehämmert, die, kaum wahrnehmbar nur für den Bruchteil einer Sekunde groß erschienen, und ein dokumentarischer Beitrag zum Geschehen auf der Bühne waren (Video M + M (Weis/De Mattia)). An „Inhalt“ und „Form“ wurde ebenso erinnert, allerdings, und auch hier folgte Regisseur Kastenmüller der Brechtschen Theatertheorie, lediglich als vorgezeigte Schrifttafel. Im Verlauf der Szenen kamen Leute zu Wort, die mit ihrem Engagement Positives bewirken wollten. Eine Übersetzerin, gespielt von Hanna Scheibe, rang um das richtige Wort, das so folgenreich für den Sprecher und seiner Zukunft sein konnte. Der von Vincent Glander gegebene Psychiater geriet immer wieder an seine Grenzen, denn was die Situation ihm abforderte, überstieg das Maß menschlicher Fähigkeiten. Er musste sich für Suizide verantworten, weil er sie nicht rechtzeitig erkannt hatte. Mareike Beykirch spielte eine Filmemacherin, die den Bildern und dem ganzen System nicht mehr vertraute und vor Ort in den Lagern nach der Wahrheit suchen wollte.
Dieser erste Teil war eine wahre Flut an Geschichten und Bildern, die zum Teil mit äußerster Expression von der Bühne ins Publikum geschleudert wurden. Mit dem zweiten Teil: „Prometheus. Wir Anfänge“ wurde dann die grundsätzlichste aller Fragen gestellt, nämlich: War es sinnvoll, den Menschen die Möglichkeit zur Entwicklung überhaupt einzuräumen, in dem man ihnen das Feuer gab? Immerhin sagt es eine Menge über den Zustand der Welt aus, wenn es (scheinbar) Sinn macht, diese Frage überhaupt zu stellen. Der zweite Part wurde von den Göttern verhandelt. Io, (Mareike Beykirch) auf der Flucht vor dem Zorn der Hera, Gattin des Zeus, die ihrem Mann beim Ehebruch mit Io ertappt und sie in eine Kuh verwandelt hatte, wurde zum Sinnbild der Flüchtigen ohne Aussicht auf Erlösung. Die versagte ihr auch Kraftprotz Atlas (Camill Jammal), schließlich hatte er keine Hand frei, da er das ganze Universum auf seinen Schultern trug.
Letztlich wurde Prometheus (Max Meyer) an seinem Felsen zur Rede gestellt. Seine Ketten fesselten ihn schon lange nicht mehr. Er, der wusste, wann die Herrschaft des Zeus enden würde, war ein Wissender und somit ein Überlegener. Doch er wurde bedrängt von den Okeaniden, hellblau gewandete Töchter des Okeanos und Bewohnerinnen der Meere, denn sie waren konfrontiert mit den Leichen der Ertrunkenen und dem ausufernden Zivilisationsmüll. Als Prometheus schlussendlich die Gretchenfrage gestellt wurde, blieb er standhaft und verteidigte seine rebellische Tat unerschütterlich und ohne Kleinmut. Auf die Frage an Kevin Rittberger, ob es angesichts der Zustände Anlass zur Hoffnung gibt, antwortet der in dem Interview, abgedruckt im Programmheft, ohne zu zögern: „Immer.“
Die Inszenierung von Peter Kastenmüller ist sehr aufwendig, detailreich und ästhetisch ambitioniert, denn Brecht genießt hier im Geist auch nicht immer Asyl. Der Text von Kevin Rittberger, insbesondere der des zweiten Teils bewegt sich in Dramatik und Gestalt auf höchstem Niveau. Der Chor mit der präzisen Einstudierung von Jan Höft war ein zentrales Element der Inszenierung und knüpfte sehr deutlich sowohl an die Antike, als auch an Brecht an. Die Musik von Polly Lapkovskaja vervollkommnete die Sicht auf das Gesamtwerk als eine sehr moderne Inszenierung, die Traditionelles aufhob und bei aller Schwere des Inhalts mit hohem sprachlichen Anspruch überzeugte.
Dennoch blieb die Inszenierung, die zwar das Prinzip Hoffnung vertrat, eine grundsätzliche Antwort schuldig. Wird sich das Blatt in der Menschheitsgeschichte irgendwann einmal dahingehend wenden, dass der globale Suizid abgewendet wird? Langsam reicht das Prinzip Hoffnung nicht mehr aus. Langsam wird es Zeit zu handeln und grundsätzlich andere Voraussetzungen zu schaffen, um noch rechtzeitig die Kurve zu bekommen. Ein Ansatz für das Umdenken ist die Besitzfrage oder die Frage nach dem: „Rechnet sich das?“ Warum ist das so schwierig? Das Leben an sich rechnet sich doch nicht. Schließlich endet es mit dem Tod. Warum nicht vorher noch einmal die Systemfrage ins Auge fassen?
Wolf Banitzki
Kassandra/Prometheus. Recht auf Welt
UA/Auftragswerk
von Kevin Rittberger
Teil I: Kassandra oder die Welt als Ende der Vorstellung
Teil II: Prometheus. Wir Anfänge
| Mit: Hanna Scheibe, Massiamy Diaby, Vincent Glander, Florian Jahr, Camill Jammal, Delschad Numan Khorschid, Noah Saavedra, Yodit Tarikwa, Max Mayer, Mareike Beykirch, Benito Bause Inszenierung: Peter Kastenmüller |