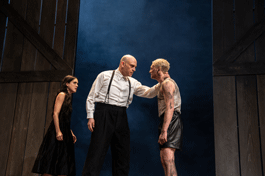Residenztheater Der starke Stamm von Marieluise Fleißer
Lockruf des Mammons
Der Sattlermeister Leonhardt Bitterwolf hat seine Frau zu Grabe getragen und noch während des Totenschmauses werden Begehrlichkeiten laut. Allen voran fordert die Schwägerin Balbina Puhlheller ihren Teil an der Hinterlassenschaft der Schwester. Und wenn das Thema schon mal zur Sprache kommt, erinnert sich der Schwager an eine Nähmaschine, für die es wohl keine Verwendung mehr gibt. Sattlermeister Bitterwolf ist ein redlicher Mann, dem der Run auf das Erbe zuwider ist. Er denkt nicht daran, zu teilen. Dabei ignorierte er allerdings auch die Wünsche seines Sohnes Hubert, der gern auf eine Kunstmalschule gehen würde. Derart versponnene Ideen tut Bitterwolf mit Beiläufigkeit ab.
Bitterwolf ist der Herr im Haus und er bestimmt über den Lebensweg seiner Nachkommenschaft. Doch auch er ist anfällig für das Roulette des Lebens. So lässt er sich auf ein Geschäft mit Glücksspielautomaten ein, das die Schwägerin in der Umgebung betreibt und das viel böses Blut schafft, denn bald schon begreifen die Spieler, dass sie „ausgeschmiert“ werden. Balbina zieht bei Bitterwolf ein, und macht dessen Haus zu ihrer Operationsbasis, allerdings nicht ohne den Hintergedanken, Bitterwolf ins Ehejoch zu spannen. Der zieht es allerdings vor, ins Bett der Magd Annerl zu schlüpfen, die er später, im Angesicht des Bankrotts ehelichen wird. Das Geschäft mit den Glückspielautomaten stellt sich schnell als ökonomischer Flopp heraus. Schulden laufen auf und Balbina prellt alle um ihren Anteil. Zuallererst Hubert, der für sie den Fahrer macht und sich dadurch finanzielle Unabhängigkeit erhofft. Enttäuscht und verzweifelt verdingt sich der junge Mann schließlich im Bergwerk.
Im Nachbarort gibt es unerwartet eine Marienerscheinung und ein sakrales Tourismusgeschäft zieht am Horizont auf. Balbina springt auch auf diesen Zug auf, macht erneut Schulden und muss ins Gefängnis, wo sie einer anderen Erbschleicherin begegnet und den Tourismusdeal perfekt machen kann. Am Ende steht Bitterwolf mit einer Frau da, die nur seinen Besitz geliebt hat. Beide müssen zuschauen, wie dieser Besitz gepfändet wird. Übrigens von einem Vetter Bitterwolfs. Balbina findet im Metzgerjackl einen neuen Geschäftspartner und das Roulette dreht sich weiter, in dem jeder versucht, an den Besitz des anderen zu kommen. Zuletzt erscheint der Onkel von Rottenegg, ein wirklich reicher Mann, auf dessen Besitz bereits alle schielen, und mischt die Karten noch einmal ganz neu, nicht ohne tiefe Befriedigung über das Entsetzen der anderen.
Mit „Der starke Stamm“ schuf Marieluise Fleißer ein Stück, das brandaktuell ist, spiegelt es doch auf einfache und leicht verständliche Weise das Wesen des Kapitalismus. Es gibt in dem ganzen Figurenensemble nur einen einzigen Menschen, der mit seiner Arbeit echte Werte generiert. Das ist der Sattlermeister Bitterwolf. Alle anderen versuchen über Anwendung von Erbgesetzen, finanzielle Spekulationen bei Ausnutzung von Leidenschaften (Spielsucht) oder religiösem Eifer (Sakraltourismus) Gewinne zu generieren, ohne dabei tatsächliche Werte zu schaffen. Das menschliche, das gesellschaftliche Zusammenleben ist geprägt von der Gier nach Besitz und von der Notwendigkeit des Erwerbs, denn alles im Leben ist ausgepreist und niemand kann sich diesen Zwängen entziehen.
| |
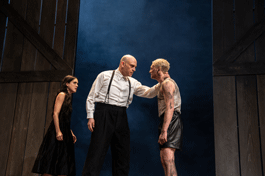 |
|
| |
v.l. Luana Velis, Robert Dölle, Johannes Nussbaum
© Sandra Then
|
|
Heraus kommt eine Gesellschaft von Egoisten und selbstentfremdeten Menschen, die niemandem, nicht einmal der Familie vertrauen können, denn Eines ist gewiss, es gibt immer jemanden, der auf den Besitz schielt. Diese Einschätzung mag erschrecken und man mag sich auch gern darauf berufen, dass die Realität sich ganz anders anfühlt und auch aussieht. Man nennt das gesellschaftliche Kultur, häufig ist es aber nur Makulatur, denn das Wesen der kapitalistischen Gesellschaft ist festgeschrieben seit Adam Smith, der sagte: „Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht.“ Leider bedeutet dieser Satz im Umkehrschluss auch, dass, wer nicht seinem unbedingten Egoismus folgt und sich über Gebühr dem Solidargedanken und dem Bewusstsein, gesellschaftliches Wesen zu sein, verpflichtet fühlt, sich alsbald auf der Seite der Verlierer wiederfindet und damit seine menschenwürdige Existenz gefährdet.
Julia Hölscher brachte dieses „Volksstück“ nun auf die Bühne des Residenztheaters und überzeugte dabei sowohl mit der inhaltlichen Bewältigung des Stoffes, wie auch mit der ästhetischen Brechung. Ihre nüchterne und klare Herangehensweise verhinderte zuallererst eines, nämlich Bauerntheater. An Gemüt mangelte es dabei nicht, wobei es kein Gemüt aus Lokalkolorit oder Folklore war, sondern das Gemüt einer sozialen Schicht, die sehr ambivalente Züge trägt. Geprägt ist diese Schicht von patriarchalischen Zügen, in denen allerdings auch Frauen naturgemäß zu bissigen und berechnenden Protagonistinnen werden können, wenn es um die Durchsetzung ihrer (hier zumeist finanziellen) Interessen geht.
Die Bühne von Paul Zoller, bestehend aus einem groben und tragfähigen Dielenboden und einem riesigen Scheunentor suggerierte zwei wesentliche Elemente: zum einen eine ungebrochene generationenübergreifende Tradition der Familienexistenz, durchaus mit einem starken Stamm vergleichbar, und zum anderen die Wehrhaftigkeit dieser Sippe, die sich allerdings auch der äußeren Welt gegenüber abzuschotten vermag. Eine Heimstatt des Fortschritts sieht anders aus.
Julia Hölscher baute ganz auf die Sprache Marieluise Fleißers, die zwar bayerisch klingt, aber ähnlich wie bei Horvath eine Kunstsprache und ungeheuer wirkmächtig ist. Die zum Klingen zu bringen brauchte es echte und kernige Resonanzkörper. Robert Dölle als Leonhardt Bitterwolf war in Hölschers Inszenierung genau das. Wie ein Fels in der Brandung aufgebaut, donnerte er seine Lebensmaximen in den Raum, unerschütterlich bis zuletzt. Seine Gegenspielerin Balbina Puhlheller, ebenso unverwüstlich und unüberwindlich von Katja Jung gegeben, war eine Frau, frei von Skrupeln und gänzlich dem Lockruf des Mammons verfallen. Sie schreckte auch nicht davor zurück, in beigefarbener großer Robe ihre weiblichen Reize in die Waagschalen zu werfen.
Allein, gegen die Anmut und die Jugend der Magd Annerl hatte sie wenige Chancen. Bitterwolfs Testosteronschübe halfen ihm leicht über die Bedenken hinweg, dass das Annerl jünger als sein Sohn war. Luana Velis brachte eine kühl berechnende Magd auf die Bühne, denn eigentlich fühlte sich das Annerl zum Sohn hingezogen, entschied sich dann aber doch für den Besitz und wurde am Ende bitter enttäuscht. Erlöst wurde immerhin Hubert, „irgendwie anders“ und „aus der Art geschlagen“, agil und bereits denselben Starrsinn wie der Vater entwickelnd von Johannes Nussbaum gestaltet.
Seine Rettung kam in der Person des „geldigen“ Onkels von Rottenegg. Arnulf Schumacher donnerte im Outfit eines Altrockers auf einer fetten Intruder auf die Bühne und machte seine endgültigen und unerschütterlichen Ansagen. Das hatte auch komische Züge. Unbedingt erwähnenswert ist, wenn es um Komik geht, der Auftritt der drei Damen Pascale Lacoste, Isabella Lappé und Christel Riedel, die in religiöser Verzückung bei Balbina ihre Tickets für den Marientrip lösten. Balbina, zuletzt in der Allianz mit dem Metzgerjackl, in schmierigem Feinripp süffisant von Niklas Mitteregger gegeben, ließ keinen Zweifel daran, dass die Geschäfte gedeihen würden. Da wuchs zusammen, was zusammen gehörte.
Man mag sicherlich darüber nachdenken, ob es sich hier um ein rein bayerisches Volksstück handelt. Die Sprache suggeriert das. Wer sich allerdings im Land und im Leben umgeschaut hat weiß, dass diese Geschichte ebenso in einer vorpommerschen Kleinstadt, in einem Tal in der Eifel oder im Erzgebirge hätte passiert sein können. Insofern ist es müßig, darüber nachzudenken, ob die bayrische Seele berührt wird. Das hieße, den wunderbaren Text von Marieluise Fleißer gering schätzen. Selbstredend passt es auf Bayern, und darauf wies auch die katholische Kleiderordnung (vorwiegend schwarz), entworfen von Meentje Nielsen, hin. Das Annerl war zuletzt immerhin in Blau gewandet. Auch für das Verständnis ist es nicht von Nachteil, wenn man zumindest des ein wenig des Hochbayrischen mächtig ist. Doch darüber hinaus ist es ein grandioses Drama, das durch Julia Hölscher und ihren Mitstreitern auf der Bühne des Residenztheaters ebenso grandios Gestalt annahm.
Wolf Banitzki
Der starke Stamm
Volksstück von Marieluise Fleißer
Mit: Robert Dölle, Johannes Nussbaum, Katja Jung, Luana Velis, Arnulf Schumacher, Niklas Mitteregger, Christian Erdt, Pascale Lacoste, Isabella Lappé, Christel Riedel
Inszenierung: Julia Hölscher
|
Residenztheater Leonce und Lena nach Georg Büchner
In der Finsternis des Unterbewussten
Alles in allem ist die Geschichte von „Leonce und Lena“, obgleich Fragment geblieben, eine runde. Beide sind, ohne sich zu kennen, füreinander bestimmt. Leonce, Prinz aus dem Reiche Popo, und Lena, Prinzessin aus dem Reich Pipi, sollen miteinander vermählt werden. Zugleich will Peter, König von Popo, sein Amt mit der Hochzeit an seinen Sohn übertragen, um dann einer Beschäftigung nachzugehen, für die er bislang wenig Gelegenheit hatte: Denken. Dabei ist er beinahe so etwas wie ein Philosoph: „Der Mensch muß denken und ich muß für meine Unterthanen denken, denn sie denken nicht, sie denken nicht. – Die Substanz ist das 'an sich', das bin ich.“ Doch weder Denken, noch andere sinnvolle Tätigkeiten sind bei Hofe so recht in Mode. So gesteht beispielsweise Valerio, Freund und Untergebener von Leonce, freimütig: „Herr, ich habe die große Beschäftigung, müßig zu gehen, ich habe eine ungemeine Fertigkeit im Nichtsthun, ich besitze eine ungeheure Ausdauer in der Faulheit.“
Es ist Lena, die zuerst darauf kommt, dass es weder moralisch noch rechtens sein kann, dass zwei Unbekannte miteinander vermählt werden sollen: „Aber warum schlägt man einen Nagel durch zwei Hände, die sich nicht suchten? Was hat meine arme Hand gethan?“ Uneinsichtig wie sie ist und bleibt, macht sie sich mit der Gouvernante auf und davon, nach Italien. Ebenso Leonce, der einen Sinn im Leben sucht, anstatt ein „nützliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft (zu) werden“ und schließlich einem Drange folgt: „Fühlst du nicht das Wehen aus Süden? (…)Wir gehen nach Italien.“
Gesagt, getan. Doch bald schon stellt sich Überdruss ein: „Wir sind schon durch ein Dutzend Fürstenthümer, durch ein halbes Dutzend Großherzogthümer und durch ein paar Königreiche gelaufen und das in der größten Uebereilung in einem halben Tag, und warum? Weil man König werden und eine schöne Prinzessin heirathen soll.“ Der Mann ist ja grundsätzlich nicht abgeneigt, doch hat Leonce ein sehr genaues Bild von seiner Zukünftigen, die es zu finden gilt, vor Augen: „Sie ist unendlich schön und unendlich geistlos. Die Schönheit ist da so hülflos, so rührend, wie ein neugebornes Kind. Es ist ein köstlicher Contrast. Diese himmlisch stupiden Augen, dieser göttlich einfältige Mund, dieses schafnasige griechische Profil, dieser geistige Tod in diesem geistigen Leib.“
In einem Gasthof geschieht dann das Naheliegende, Leonce und Lena begegnen und verlieben sich. Nun braucht es einen Einfall, wie man zusammen und zudem nach Hause kommen kann. In Popo laufen die Hochzeitsvorbereitungen auf Hochtouren, obgleich das Brautpaar verschollen ist. Protokoll ist Protokoll und das tut der Landrat kund: „Sämmtliche Unterthanen werden von freien Stücken, reinlich gekleidet, wohlgenährt, und mit zufriedenen Gesichtern sich längs der Landstraße aufstellen.“ Das jämmerliche Volk tut sein Bestes und der Landrat belohnt es: „Erkennt was man für euch thut, man hat euch grade so gestellt, daß der Wind von der Küche über euch geht und ihr auch einmal in eurem Leben einen Braten riecht.“
Leonce und Lena, Valerio und die Gouvernante passieren die Grenze Popos maskiert und geben vor, Automatenmenschen zu sein, in denen sich die ersten Regungen der Liebe zeigen. Man könnte sie sogar verheiraten. Da nun gerade das ganze Aufgebot steht und es an einem Brautpaar mangelt, sieht der König die Möglichkeit, die Festivität dennoch stattfinden zu lassen und das Automatenpaar als Leonce und Lena zu verkaufen. König Peter: „Jetzt hab' ich's. Wir feiern die Hochzeit in effigie. (Auf Leonce und Lena deutend.) Das ist der Prinz, das ist die Prinzessin. Ich werde meinen Beschluß durchsetzen, ich werde mich freuen.“ Nach der Trauung und der Demaskierung sind alle entsetzt, wollen alles annullieren, kommen allesamt wieder zur Vernunft und belassen es bei diesem Status.
| |
 |
|
| |
v.l. Barbara Melzl, Lisa Stiegler, Steffen Höld, Annalisa Derossi, Elias Eilinghoff, Daniele Pintaudi
© Sandra Then
|
|
Eine Komödie, möchte man meinen, doch im historischen Kontext betrachtet ist dieses Stück weit mehr. Was Büchner sechzehnjährig in seinem Hessischen Landboten noch dokumentierte und analysierte, karikierte er in seiner 1836 geschriebenen und erst 1895 in München uraufgeführten Komödie „Leonce und Lena“ in bis dato kaum gekannter Schärfe. Er stellte darin den Adel als faul, ignorant, degoutant und völlig verblödet dar. So lässt er den König zum Beispiel sagen: „Wenn ich so laut rede, so weiß ich nicht wer es eigentlich ist, ich oder ein Anderer, das ängstigt mich.“ Die Ableger des Adels kommen keinen Deut besser weg. Er legt Leonce, nachdem der schwülstige Todesfantasien entwickelt und Valerio ihm in die Parade fährt, die Worte in den Mund: “ Mensch, du hast mich um den schönsten Selbstmord gebracht. Ich werde in meinem Leben keinen so vorzüglichen Augenblick mehr dazu finden und das Wetter ist so vortrefflich. Jetzt bin ich schon aus der Stimmung.“ Nach der Eheschließung beschwört das Paar ein Paradies, das blödsinniger kaum genannt werden kann: „Und dann umstellen wir das Ländchen mit Brennspiegeln, dass es keinen Winter mehr gibt und wir uns im Sommer bis Ischia und Capri hinaufdestillieren, und wir das ganze Jahr zwischen Rosen und Veilchen, zwischen Orangen und Lorbeern stecken.“
Büchner machte sich ebenso lustig über die deutsche Kleinstaaterei, man durchquerte ein Dutzend Fürstentümer an einem halben Tag, aber auch über das Volk, das wie Schafe sein Los erduldet und dankbar dem Bratenduft hinterher schnuppert. Es steckt viel Bitternis darin, denn Büchner, der bereits als Teenager steckbrieflich gesucht wurde, der in seinem Versteck „Dantons Tod“ schrieb, hatte alle Hoffnung fahren lassen, dass die Ideale der französischen Revolution, von den Franzosen selbst verraten, in Deutschland noch Wirkung zeitigen könnten. Georg Büchner, der vierundzwanzigjährig starb, war vollkommen desillusioniert und schrieb ein Stück, das in die erste Reihe des Theaters des Absurden gestellt werden könnte. Allein, er schrieb es gut einhundert Jahre früher. Warum nun diese ausführlichen Erläuterungen zum Stück, wird sich der eine oder andere Leser fragen. Es scheint angebracht, ein wenig mehr über das Stück zu erzählen, denn in der Inszenierung am Münchner Residenztheater wird davon nicht viel wieder zu erkennen sein und das führt vermutlich zu Irritationen.
Regisseur Thom Luz, der zuletzt mit „Olympiapark in the Dark“ im Marstall eine eigenwillige, substantielle und witzige Inszenierung ablieferte, hatte für „Leonce und Lena“ eine ebenso eigenwillige Herangehensweise gewählt. Sein Ansatz liest sich wie folgt: „Bei der genaueren Lektüre stellt man aber fest, dass seltsame Lücken, Risse und Leerstellen zwischen den Textzeilen klaffen – und auch die Figuren selbst voller unverfugter Abgründe sind, in die man als Leser*in, Schauspieler*in oder Regisseur ständig hineinfällt und an deren Boden die großen Menschheitsfragen funkeln: wer, weshalb, wohin.“ (Programmheft zum Stück) Klingt durchaus interessant, schließlich ist diese Inszenierung ja nicht von, sondern nach Büchner. Anhängig ist im Text eine Vielzahl an Fragen.
Die werden allerdings unter Berufung auf John Cage nicht beantwortet, der da sagte: „Das ist eine wunderbare Frage, die ich nicht mit einer Antwort verderben möchte.“ Allein, am Ende zählt, was auf der Bühne zu sehen ist und ob der Zuschauer sich dreinfindet. Zuerst war einmal eine Menge zu hören auf der Bühne. Drei Klaviere wurden von Annalisa Derossi und Daniele Pintaudi eifrig bespielt. Und damit begann schon das Dilemma, denn die musikalischen Motive waren so vielfältig, dass sich ein Grundtenor kaum ausmachen ließ. Ebenso ließen sich die Darsteller kaum durchgängig einer Rolle zuweisen. Die Texte wurden in den Raum gestellt, ohne dass sie einem Erzählstrang folgten und wenn, dann war der nur schwerlich auszumachen. Insofern war es bei Unkenntnis des Stückes kaum möglich, den Inhalt tatsächlich zu erfassen.
Ein weiterer großer Vertreter muss herangezogen werden, um zu verstehen, was auf der Bühne des Residenztheaters passierte. Gemeint ist der Symbolist Maurice Maeterlinck, der im Programmheft mit seinem Text „Androiden Theater“ vertreten ist und darin wird das „Unbewusste“ angegeben. Maeterlinck nennt darin das Theater den „Tempel des Traums“ und verweist zugleich darauf, dass dies ein sehr altes Missverständnis sei. Aber der Mensch neigt dazu, seinen Instinkten zu folgen und somit dieses Missverständnis aufrecht zu erhalten. Doch genau dieses Bild, das Bild von einem Traumspiel, stellte sich für den Betrachter der Inszenierung dar. Allerding verliefen sich die Figuren immer wieder in den oben genannten „seltsamen Lücken, Rissen und Leerstellen“ und wurden zu Posen, nicht selten zu musikalischen Posen. Dabei wurde die Realität bis zu einer totalen Finsternis (Im wahrsten Sinn des Wortes!) herunter gefahren und im Raum verblieb nur noch das gesprochene Wort. Dabei wurde das Wort mehr Klang als bedeutungsvolle Sprache, denn es wurde keine konkrete Situation mehr erkennbar.
So saßen die Zuschauer eine Stunde und 25 Minuten vor einem Geschehen, dem sie nicht immer folgen konnten, weil eine Zuordnung der Figuren zur diskontinuierlich erzählten Handlung sehr schwer war, aber auch, weil die Bühnensituation die Geschichte nicht zusammenhielt. Thom Luz, der auch für die Bühne verantwortlich zeichnete, bespielte sie in ihrer ganzen Tiefe, wodurch Schlüsselszenen, wie das Maskenspiel, vor einem großen Spiegel extrem weit vom Publikum wegrückten. Sehr vieles erging sich in Andeutungen wie das Spiel mit den Kostümen (Tina Bleuler), aber auch die Musik (Leitung Mathias Weibel). So war man als Zuschauer ständig bemüht, nach Interpretationen zu suchen, was vielen Zuschauern letztlich nicht gelang und das Publikum deutlich spaltete, wobei fraglich ist, ob denen, die die Inszenierung frenetisch beklatschten, eine Erleuchtung zuteilwurde.
Tatsächlich blieb, anders als bei „Olympiapark in the Dark“, wenig Substanzielles im Gedächtnis und irgendwie wurde man mit dem Gefühl entlassen, um das wunderbare Stück „Leonce und Lena“ geprellt worden zu sein. Dabei sollen keine Konventionen beschworen werden. Allerdings sind Zweifel angebracht, ob der zum Teil recht beschwerliche, ästhetisch traumhaft anmutende Tanz in den „seltsamen Lücken, Rissen und Leerstellen“ durch das „Spiegellabyrinth zwischen Thron- und Tanzsaal und dem Irrenhaus“ ein hinreichender Ersatz für die Geschichte und die kaum zu überschätzende Sprachkunst Büchners war. Etliche Buhs sprachen nicht unbedingt für eine ungeteilte Sicht.
Wolf Banitzki
Leonce und Lena
nach Georg Büchner
Mit: Annalisa Derossi, Elias Eilinghoff, Steffen Höld, Barbara Melzl, Daniele Pintaudi, Lisa Stiegler
Inszenierung: Thom Luz
|